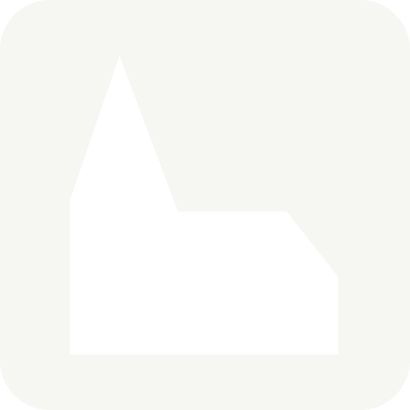Johann Gramann, genannt Poliander
1487–1541
»Nun lob, mein Seel, den Herren«, Nachdichtung von Psalm 103, 1540
Johann Gramann, genannt Poliander
1487–1541
Johann Gramann wurde am 5. Juli 1487 als Sprößling einer Handwerkerfamilie in Neustadt an der Aisch in Unterfranken geboren. Nach dem ausgiebigen Studium der Philosophie und Theologie in Leipzig ab 1503 wurde er zunächst 1516 Lehrer und 1520 Rektor an der dortigen traditionsreichen Thomasschule. Er freundete sich mit dem Humanisten Petrus Mosellanus an und begann auch seinen eigenen Nachnamen in altgriechischer Form zu verwenden. Aus »Gramann« wurde »Graumann«, was sich wiederum sehr leicht gräzisieren ließ. Als »Poliander« – zusammengesetzt aus den griechischen Begriffen »polios« (grau) und »aner« beziehungsweise »andros« (Mann) – verdeutlichte Johann Gramann seine Nähe zu humanistischen Überzeugungen und vor allem zu den Bildungsidealen.
1519 erlebte er als Protokollant des Theologieprofessors Johann Eck die sogenannte »Leipziger Disputation« mit Martin Luther und Andreas Bodenstein in direkter Weise mit. Dieses theologische Streitgespräch, das für die beginnende Reformation richtungsweisend sein sollte, beeindruckte Johann Gramann so sehr, dass er nach Wittenberg ging. Dort studierte er noch einmal, weil er, so seine eigenen Worte »von dem Fechtmeister Eck zu dem Gewissensstreiter Luther überging«. Als früher und überzeugter Anhänger Martin Luthers und Philipp Melanchthons wurde Johann Gramann 1522 Domprediger in Würzburg. Drei Jahre später suchte Herzog Albrecht von Preußen (1490–1568) für die Altstädter Kirche in Königsberg einen »tapferen christlichen Priester«. Martin Luther empfahl Johann Gramann für diese Stelle, da ihn der Bauernaufstand aus Würzburg vertrieben hatte und er sich zeitweilig in Nürnberg aufhielt. So nahm Johann Gramann das Angebot an und zog 1525 oder 1526 nach Ostpreußen, wo er zusammen mit Paul Speratus (1484–1551) Kirchengemeinden reformierte und ein protestantisches Schulwesen aufbaute. Beide wurden mit Johannes Brießmann von Martin Luther als »Prussorum Evangelistae« (Evangelisten Preußens) bezeichnet.
Unter anderem gründete Johann Gramann jene Schule, aus der ab 1544 die Königsberger Universität hervorging. Als sich der Königsberger Herzog Albrecht von Preußen von seinem Hofprediger eine musikalische Fassung von Psalm 103 (»Lobe den Herrn, meine Seele«) wünschte, entstanden die ersten vier Strophen des Liedes »Nun lob, mein Seel, den Herren« (1530, EG 289). Dieses Lied verbreitete sich sehr schnell mit den damals an vielen Orten neu entstandenen evangelischen Gesangbüchern. Denn die Reformation brauchte deutschsprachige, verständliche und eingängige Lieder, um die für sie wichtigen Standpunkte sinnfällig zum Ausdruck zu bringen. Viele Lieddichter jener Umbruchszeit hielten sich an eine Vorlage, zum Beispiel an einen Psalm, einen Hymnus oder ein Stück aus dem Katechismus. So entstanden manchmal textlich durchaus holprige Choräle. Die vier Strophen Johann Gramanns hingegen brachten eine neue, heitere und aufmunternde Farbe in den reformatorischen Gesang. Ein weiteres Lied »Fröhlich will ich sing’n, keiner Traurigkeit mehr pfleg’n; Zeit tut Rosen bring’n, die Sonne kommt nach dem Reg’n« wurde 1540 veröffentlicht. Es findet sich aber nicht mehr im Evangelischen Gesangbuch. Auch in diesem Text zeigt sich, wie der Pädagoge und Seelsorger Johann Gramann stets das Motivierende des damals neuen Glaubens hervorgehoben hat. Auch in zahlreichen Diskussionen mit den Anhängern von Kaspar Schwenckfeld (1490–1561), der einen radikalen Spiritualismus vertrat, konnte er mit Geduld, Freundlichkeit und Klarheit weitere Eskalationen verhindern.
Im Alter von 54 Jahren starb Johann Gramann am 29. April 1541 in Königsberg. Über hundert Jahre später wurde 1648 der Westfälische Friede als Ende des Dreißigjährigen Krieges unter den Klängen von »Nun lob, mein Seel, den Herren« verkündet.
Text Strophe 5: Königsberg 1549 Melodie: 15. Jahrhundert »Weiß mir ein Blümlein blaue«; geistlich Hans Kugelmann (um 1530) 1540
Johann Gramann:
Nun lob, mein Seel, den Herren (EG 289) – Athesinus Consort Berlin, Klaus-Martin Bresgott
Nun lob, mein Seel, den Herren (EG 289)
1. Nun lob, mein Seel, den Herren,
was in mir ist, den Namen sein.
Sein Wohltat tut er mehren,
vergiss es nicht, o Herze mein.
Hat dir dein Sünd vergeben
und heilt dein Schwachheit groß,
errett’ dein armes Leben,
nimmt dich in seinen Schoß,
mit reichem Trost beschüttet,
verjüngt, dem Adler gleich;
der Herr schafft Recht, behütet,
die leidn in seinem Reich.
2. Er hat uns wissen lassen
sein herrlich Recht und sein Gericht,
dazu sein Güt ohn Maßen,
es mangelt an Erbarmung nicht;
sein’ Zorn lässt er wohl fahren,
straft nicht nach unsrer Schuld,
die Gnad tut er nicht sparen,
den Schwachen ist er hold;
sein Güt ist hoch erhaben
ob den’, die fürchten ihn;
so fern der Ost vom Abend,
ist unsre Sünd dahin.
3. Wie sich ein Mann erbarmet
ob seiner jungen Kindlein klein,
so tut der Herr uns Armen,
wenn wir ihn kindlich fürchten rein.
Er kennt das arm Gemächte
und weiß, wir sind nur Staub,
ein bald verwelkt Geschlechte,
ein Blum und fallend Laub:
der Wind nur drüber wehet,
so ist es nimmer da,
also der Mensch vergehet,
sein End, das ist ihm nah.
4. Die Gottesgnad alleine
steht fest und bleibt in Ewigkeit
bei seiner lieben G’meine,
die steht in seiner Furcht bereit,
die seinen Bund behalten.
Er herrscht im Himmelreich.
Ihr starken Engel, waltet
seins Lobs und dient zugleich
dem großen Herrn zu Ehren
und treibt sein heiligs Wort!
Mein Seel soll auch vermehren
sein Lob an allem Ort.
5. Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist!
Der wolle in uns mehren,
was er aus Gnaden uns verheißt,
dass wir ihm fest vertrauen,
uns gründen ganz auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass unser Mut und Sinn
ihm allezeit anhangen.
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen,
glaubn wir von Herzensgrund.
Kirchen / Wirkungsstätten
- Martin-Luther-Kirche, Würzburg
- Nikolaikirche, Leipzig-Zentrum
- Peterskirche, Leipzig-Zentrum-Süd
- Stadtkirche St. Marien zu Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg
- Schlosskirche Allerheiligen, Lutherstadt Wittenberg
- St. Lorenz, Nürnberg
- St. Johannis, Würzburg
- St. Maria, Neustadt an der Aisch-Birkenfeld
- Stadtkirche St. Johannes der Täufer, Neustadt an der Aisch
- Thomaskirche, Leipzig