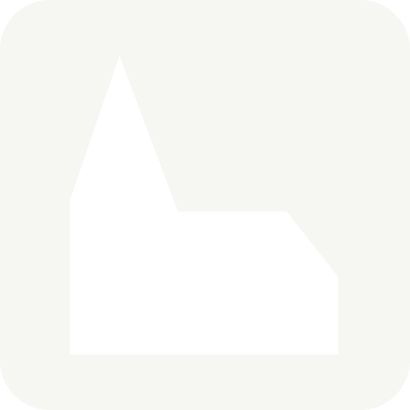Ernst Moritz Arndt
1769–1860
Ernst Moritz Arndt am Rubenowdenkmal in Greifswald
Ernst Moritz Arndt
1769–1860
Ernst Moritz Arndt wurde am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 1769 in Groß Schoritz auf der Insel Rügen geboren. Zu dieser Zeit (vom Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 bis zur Neuordnung Europas 1815) gehörte die Insel zu Schweden. Der Vater Ludwig Nikolaus Arndt war einer der ersten, der sich aus der Leibeigenschaft des Grafen Malte Friedrich zu Putbus freigekauft hatte und arbeitete als Inspektor, später als Pächter verschiedener Güter auf Rügen. Die Mutter Friederike Wilhelmine war nach Bekunden des Sohnes eine ausdauernde Geschichtenerzählerin und führte den Jungen früh an die Sagenwelt und die Geschichten der Bibel heran. Nach häuslichem Unterricht ging Ernst Moritz Arndt 1787 bis 1789 auf das Gymnasium des Stralsunder Katharinenklosters, hatte dann unterschiedliche Auffassungen über den Sinn des Schulbesuchs, was zu Auseinandersetzungen mit seinem Vater führte, und machte 1791 schließlich seinen gymnasialen Abschluss vom elterlichen Gut in Löbnitz (nahe der Hansestadt Barth) aus.
Ab Mai 1791 studierte Ernst Moritz Arndt zunächst an der Universität der Hansestadt Greifswald und später in Jena evangelische Theologie, Geschichte, Erd- und Völkerkunde und Naturwissenschaften. Im Anschluss war er Hauslehrer bei dem berühmten Rügener Pfarrer und Dichter Ludwig Gotthard Kosegarten und schloss sich 1798/99 einer Bildungsreise durch Belgien, Frankreich, Österreich und Norditalien an. 1800 habilitierte Ernst Moritz Arndt an der Greifswalder Universität in Geschichte und Philologie mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Ideenwelt Jean-Jacques Rousseaus. Im selben Jahr heiratete er die Professorentochter Charlotte Marie Quistorp, die im Jahr darauf nach der Geburt des Sohnes Karl Moritz im Kindbett starb. 1801 wurde Ernst Moritz Arndt zunächst Privatdozent, 1806 dann außerordentlicher Professor an der philosophischen Fakultät in Greifswald. Als glühender Patriot und rhetorischer Mobilmacher gegen Napoleon flüchtete er nach der verlorenen Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 nach Schweden, kehrte von dort nach dem Sturz des schwedischen Königs Gustav IV. Adolf 1809 wieder zurück nach Deutschland und ging nach Berlin, wo er die aktive Bekanntschaft mit dem Turner und Pädagogen Friedrich Ludwig Jahn, dem Generalfeldmarschall August Neidhardt von Gneisenau und dem Theologen Friedrich Schleiermacher machte.
1812 wurde er auch aufgrund seiner Gesinnung Privatsekretär des Freiherrn von Stein in Sankt Petersburg und kehrte nach Napoleons Niederlage 1813 in seine Heimat zurück. 1816 und 1817 war er wieder in Stralsund ansässig. Im April 1817 verlobte er sich in Berlin mit Anna Maria Schleiermacher, der Schwester des Theologen, und heiratete sie im Herbst 1817. Ernst Moritz Arndt unterstützte die nationale deutsche Einheitsbewegung und die Freiheitskriege durch diverse streitbare Schriften ebenso wie den evangelischen Pietismus, was sich in seinem »Deutschen Volkskatechismus« niederschlug. 1818 ging das Paar Anna Maria und Ernst Moritz Arndt nach Bonn, wo Ernst Moritz Arndt Professor für Geschichte an der jungen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität wurde. 1819 veröffentlichte Ernst Moritz Arndt das Gedicht »Der Fels des Heils« in seiner Schrift »Von dem Wort und dem Kirchenliede«, das sich auf den Apostel Paulus und dessen 2. Brief an Timotheus bezieht. Noch zu Lebzeiten wurde das Lied in zahlreiche Gesangbücher aufgenommen. Es ist heute unter dem Titel »Ich weiß, woran ich glaube« Teil des Evangelischen Gesangbuchs. Die Melodie stammt von Heinrich Schütz (1628/1661) und wurde vom Musicus Poeticus ursprünglich auf Psalm 138 komponiert.
Schon 1820 wurde Ernst Moritz Arndt suspendiert. 1826 musste er sein Professorenamt ganz niederlegen und wurde erst 1840 durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. rehabilitiert. Am 18. Mai 1848 zog Arndt fraktionslos als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung ein, legte das Mandat aber schon nur ein Jahr später, am 20. Mai 1849, wieder nieder und widmete sich wieder dem akademischen Leben. Ernst Moritz Arndt starb am 29. Januar 1860 in Bonn.
Seit 1933 trägt die Universität Greifswald seinen Namen. Seine Haltung zu Frankreich und zum Judentum führte 2010 zu der Frage, ob sich die Universität umbenennen solle. Studenten und die Senatoren der Universität sprachen sich aber für die Beibehaltung des Namens aus.
Ernst Moritz Arndt:
Ich weiß, woran ich glaube (EG 357) – Klaus-Martin Bresgott
Ich weiß, woran ich glaube (EG 357)
1. Ich weiß, woran ich glaube,
ich weiß, was fest besteht,
wenn alles hier im Staube
wie Sand und Staub verweht;
ich weiß, was ewig bleibet,
wo alles wankt und fällt,
wo Wahn die Weisen treibet
und Trug die Klugen prellt.
2. Ich weiß, was ewig dauert,
ich weiß, was nimmer lässt;
mit Diamanten mauert
mir’s Gott im Herzen fest.
Die Steine sind die Worte,
die Worte hell und rein,
wodurch die schwächsten Orte
gar feste können sein.
3. Auch kenn ich wohl den Meister,
der mir die Feste baut,
er heißt der Herr der Geister,
auf den der Himmel schaut,
vor dem die Seraphinen
anbetend niederknien,
um den die Engel dienen:
ich weiß und kenne ihn.
4. Das ist das Licht der Höhe,
das ist der Jesus Christ,
der Fels, auf dem ich stehe,
der diamanten ist,
der nimmermehr kann wanken,
der Heiland und der Hort,
die Leuchte der Gedanken,
die leuchten hier und dort.
5. So weiß ich, was ich glaube,
ich weiß, was fest besteht
und in dem Erdenstaube
nicht mit als Staub verweht;
ich weiß, was in dem Grauen
des Todes ewig bleibt
und selbst auf Erdenauen
schon Himmelsblumen treibt.
Text: Ernst Moritz Arndt 1819
Melodie: Heinrich Schütz 1628/1661 (zu Psalm 138)
Kirchen / Wirkungsstätten
- Bugenhagenkirche, Greifswald-Wieck
- Christus-Kirche (Schlosskirche), Putbus
- Dom St. Nikolai, Greifswald
- Dorfkirche Voigdehagen, Stralsund
- Ev. Kreuzkirche Bonn – Citykirche, Bonn
- Evangelische Kirche Wald, Solingen-Wald
- Friedenskirche, Stralsund
- Heilgeistkirche, Stralsund
- Kulturkirche St. Jakobi, Stralsund
- Nikolaikirche, Berlin-Mitte
- Pauluskirche, Bonn-Friesdorf
- St. Michael, Jena
- St. Marienkirche, Berlin-Mitte
- St. Nikolai, Stralsund
- Sankt Peter, Frankfurt am Main
- St.-Marien-Kirche, Stralsund