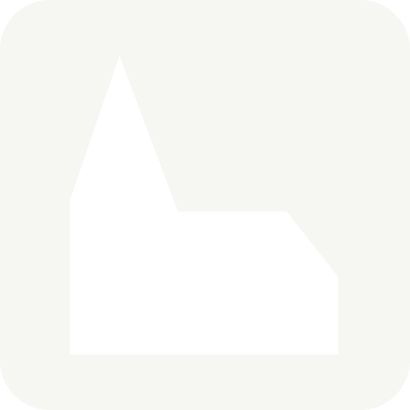Ernst Pepping
1901–1981
Ernst Pepping
1901–1981
Als er 1934 den auf Lebenslänge abonnierten Posten als Lehrer für Musiktheorie und Komposition an der Kirchenmusikschule in Berlin-Spandau antrat, hatte der am 12. September 1901 in Duisburg gebürtige Rheinländer Ernst Pepping seine experimentelle Phase bereits hinter sich. Vorausgegangen waren (nach einem Kompositionsstudium bei Walter Gmeindl) Teilnahmen an zahlreichen internationalen Festivals für zeitgenössische Musik mit etlichen Kammermusiken für zum Teil kuriose Besetzungen (so ein Concerto für Bratsche und 12 Streichinstrumente, darunter 4 Kontrabässe), schließlich mit dem »Marsch der Maschinen« sogar ein Stück Filmmusik. Mit dem Amtsantritt in Spandau indes orientierte sich Pepping auch kompositorisch neu: Vorab waren es nun geistliche Musiken – Motetten und Messvertonungen, Orgelwerke und nicht zuletzt die 250 Sätze des Spandauer Chorbuches – mit denen Pepping in den 1930er-Jahren zu einem der führenden Vertreter der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung avancierte.
Als ein komponierender »Kirchenmusiker« freilich wollte Pepping nie gelten. Sein Verständnis von Musik als einer Kunst jenseits von Vereinnahmungen jeglicher Art machte ihn vielmehr zu einem weltabgewandten Einzelgänger, der auch die nationalsozialistische Barbarei kaum je zur Kenntnis nahm. Gewiss profitierte der Komponist von Aufführungsverbot und Vertreibung renommierter Musikerkollegen. Nachweise für Anbiederungen aber, etwa in Form von NS-Auftragswerken, wie sie Zeitgenossen mitunter zahlreich vorlegten, fehlen bei Pepping ebenso wie Anzeichen einer Distanz, gar eines expliziten Widerstands gegenüber dem Terrorregime. Auch nach Ende des Dritten Reiches proklamierte Pepping unbeirrt sein Credo von der Autonomie des Kunstwerks. Begleitet von zahlreichen Ehrungen – darunter eine Professur für Komposition an der Berliner Hochschule für Musik (1953) und die Aufnahme in die Akademie der Künste (1955) – entstanden mit der »Missa Dona nobis pacem« und dem »Passionsbericht des Matthäus« – Beiträge, die Pepping zu einem der bedeutendsten Vertreter der Chormusik im 20. Jahrhundert werden ließen.
Eine kritische Reflektion der Naziherrschaft indes fand ebenso wenig statt wie eine künstlerische Neuorientierung; auch seine Programmschrift »Stilwende der Musik«, in der Pepping eine Anknüpfung an Form- und Satzideale der niederländischen Renaissance in einer Diktion niedergelegt hatte, die oft genug von dem martialischen Jargon der Nationalsozialisten inspiriert schien, hielt der Komponist nach Ende der Barbarei weder für korrektur- noch für revisionsbedürftig. So war es gerade die Verweigerung einer Teilhabe an den kompositorischen und gesellschaftlichen Wandlungen, die Pepping in der Folgezeit unzeitgemäß erscheinen ließen. Und während die 68er-Generation eine »engagierte Musik« einfordert, erlosch seine kompositorische Produktion, die die evangelische Kirchenmusik nachhaltig prägte, deren ästhetische Präsenz indes nur mehr gering ist – gestorben ist Ernst Pepping am 1. Februar 1981 in Berlin-Spandau.
Ernst Pepping:
Herr, neige deine Ohren – Athesinus Consort Berlin, Klaus-Martin Bresgott (CD »Boten«, 2011)