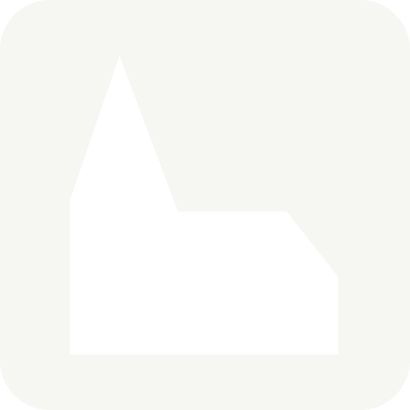Friedrich II. von Preußen
1712–1786
Adolph Menzel: »Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci«, 1852, Öl auf Leinwand, 142 × 205 cm
Friedrich II. von Preußen
1712–1786
Ein musischer Geist war er, zweifellos. Unter den preußischen Königen nimmt Friedrich II. – geboren am 24. Januar 1712 in Berlin, nachmals »der Große« genannt, damit eine gewisse Sonderstellung ein. Für Philosophie und Geschichte hat er sich interessiert und auch für theologische Fragen, die antiken Dichter studierte er ebenso wie zeitgenössische Autoren. Seine eigenen literarischen Ambitionen fanden in zahlreichen Schriften ihren Niederschlag, darunter auch in einigen auf Französisch abgefassten Prosaentwürfen zu Opernlibretti.
Im Mittelpunkt seiner Beschäftigung mit den Künsten stand jedoch die Musik. Sie bot Friedrich Zerstreuung und Erbauung, sie war Ernst und Spiel zugleich. Die wesentliche Prägung erhielt er während seiner Kronprinzenzeit, vor allem im Zuge seines Aufenthalts auf Schloss Rheinsberg, einem wahren »Musenhof«, in den späten 1730er-Jahren. In dem märkischen Städtchen versammelte Friedrich eine Reihe erstklassiger Musiker um sich, unter ihnen den Flötenvirtuosen Johann Joachim Quantz und den Komponisten Carl Heinrich Graun, den späteren preußischen Hofkapellmeister. Die zunächst noch kleine, dann immer weiter ausgebaute Rheinsberger Hofkapelle, die Friedrich nach seiner Thronbesteigung 1740 nach Berlin überführte, entwickelte sich rasch zu einem leistungsfähigen Klangkörper, der zu repräsentativen Anlässen ebenso zur Verfügung stand wie für private musikalische Unternehmungen. In seiner Förderung der Musik fuhr Friedrich stets doppelgleisig. Auf der einen Seite war er darauf bedacht, sie in Staat und Gesellschaft offiziell zu verankern: Der Bau der Königlichen Hofoper Unter den Linden gehört in diesen Zusammenhang. Mit künstlerisch hochstehenden Opernaufführungen wie mit anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (wie etwa Redouten oder Hochzeitsfeierlichkeiten) fiel auf die bislang nicht eben prachtvolle preußische Residenz der Glanz einer höfischen Kultur, wie sie in anderen europäischen Städten bereits seit Längerem etabliert war.
Auf der anderen Seite spielten sich Friedrichs Bemühungen um die Musik in kleinen Zirkeln beinahe im Verborgenen ab. Die legendär gewordenen Kammermusiken auf Schloss Sanssouci, wo der flötespielende König gemeinsam mit Gleichgesinnten sich der Musik und dem Musizieren widmete (und wo die Grenzen zwischen dem Monarchen und seinen Untertanen gleichsam verschwammen), sind das beste Beispiel dafür. Quantz und Graun waren wieder mit von der Partie, aber auch Carl Philipp Emanuel Bach. 1747 kam gar der »alte Bach« aus Leipzig für einige Tage nach Potsdam und Berlin. Für Friedrich waren diese Abende eine Zeit des Eintauchens in eine Welt abseits der großen Politik, der Staats- und Kriegsgeschäfte, in eine Welt des Schönen und Erhabenen. Es ist bezeichnend, dass er sämtliche anfallende Kosten nicht aus der Staatskasse, sondern aus seiner Privatschatulle beglich. Nicht zuletzt konnte sich Friedrich auch seiner eigenen Musik zuwenden. Er, der das Flötenspiel offenbar auf einem erstaunlich hohen, annähernd professionellen Niveau beherrschte, war bekanntlich auch kompositorisch aktiv: Mehr als 120 Sonaten für Flöte und Cembalo sind nachgewiesen, hinzu kommen vier Flötenkonzerte, drei Sinfonien und mehrere Arien. Zumindest bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts repräsentieren Friedrichs Werke den aktuellen Stand des Komponierens, danach beginnen sie ein wenig altmodisch zu wirken. Gegen Ende seines Lebens – gestorben ist Friedrich am 17. August 1786 in Potsdam – scheint er ohnehin sein vormals so großes Interesse an der Musik verloren zu haben: Von der Hofoper gehen kaum mehr Impulse aus, die praktische Musikausübung kommt zum Erliegen. Und dennoch hat Friedrich als Kronprinz wie als König dafür gesorgt, die Musen an Spree und Havel wieder heimisch werden zu lassen.
Hannes Immelmann:
Sonate G-Dur für Traversflöte und Basso Continio – Andante (CD »Friedrich II. in Potsdam. Kammermusik für Flöte«, 2011)