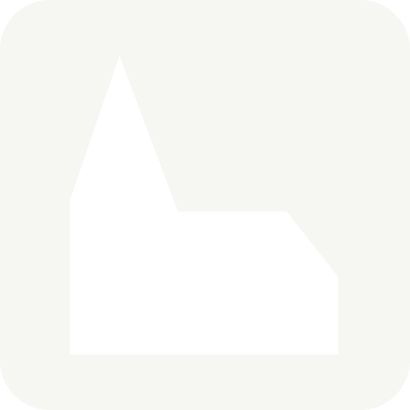Wim Wenders – Filmemacher
Filmfest München, 2014 (Foto: Harald Bischoff)
Wim Wenders – Filmemacher
Wim Wenders, geboren im August 1945 in Düsseldorf, zählt zu den bedeutendsten Filmkünstlern der Gegenwart. In einem konservativ-katholischen Arzthaushalt groß geworden, wollte er zunächst Priester werden, aber die Musik – der Rock’n’Roll – kam ihm dazwischen. Wie sie ihn beeinflusst hat, lässt sich in vielen seiner Filme sehen und hören – etwa in »Lisbon Story«, »Buena Vista Social Club«, »viel passiert – der BAP-Film« oder dem Musikvideo »Warum werde ich nicht satt?« für und mit den Toten Hosen. Er studierte einige Semester Medizin, Philosophie und Soziologie, widmete sich der Aquarellmalerei und landete schließlich beim Film, der sein Ausdrucksmittel wurde und ihm weltweit Erfolg bescherte – unter anderem mit so berühmten Filmen wie »Der Himmel über Berlin« und »Paris, Texas«, der 3D-Film-Dokumentation »Pina« über die Choreografin Pina Bausch und »Das Salz der Erde«. Seit 1996 ist Wim Wenders Präsident der Europäischen Filmakademie und lehrt seit 2003 an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Seit 2006 ist er außerdem als erster Filmschaffender überhaupt Träger des Ordens «Pour la Mérite«. Johann Hinrich Claussen hat sich mit ihm im Rahmen der Verleihung des Hans Ehrenberg-Preises unterhalten.
Herr Wenders, das Kino ist sicherlich keine moralische Anstalt. Dennoch die Frage, ob es einen humanen Charakter haben kann. Worin könnte er bestehen?
In der simplen Annahme, dass Filme durchaus lebensdienlich oder menschenfreundlich sein können und vor allem Fragen beantworten können, nämlich die einfachste, aber auch dringlichste von allen: »Wie soll man leben?« Die möglichen Antworten darauf werden heutzutage immer komplexer und vielschichtiger und undurchsichtiger. Wer bemüht sich überhaupt noch um solche Fragen? Die Kirche historisch gesehen am meisten, aber leider versagt sie heute auch oft am meisten. Wenn man einmal davon absieht, wie unermüdlich einzelne, beispielsweise Papst Franziskus, sich solchen Fragen stellen. Das Kino als populäres und weltumspannendes Medium zeigt hin und wieder, was es alles kann und wie gründlich es auf Existenzfragen eingehen kann. Wenn es nur will. Hier gilt aber leider dasselbe wie für alle Medien: »Gute Nachrichten sind keine«, niemand will den Geruch einer »moralischen Anstalt« an sich haben. Das ist heute einfach uncool. Obwohl gerade das mehr gebraucht würde als je zuvor. Das Theater und die Literatur sind genauso in der Pflicht, aber sie drücken sich auch, so gut es geht, wohl weil es gerade nicht hoch im Kurs steht, »moralische Anstalt« zu sein. Den erstaunlichsten Reichtum an Mut, sich allen Fragen zu stellen, gibt es in der zeitgenössischen Musik, ich wüsste nicht, welches andere Medium sich beispielsweise zum Thema »Tod« so explizit geäußert hätte wie Leonhard Cohen in seinem letzten Album »You Want It Darker« oder David Bowie mit »Blackstar« oder Nick Cave mit »Skeleton Tree«.
Musik spielt immer eine große und eigene Rolle in Ihren Filmen neben den Bildern und Geschichten. Wie ist Ihr Verhältnis zu geistlicher Musik oder zur spirituellen Qualität von Musik?
Über Bach geht bei mir gar nichts. Wenn es wirklich hart auf hart geht, hilft mir keine andere Musik besser, zu mir zu kommen. Musik ist die »immateriellste« aller Künste, wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf, und deswegen auch so geistlich. Sie verbindet Menschen anders als Worte und Bilder. Sie trägt weniger »Bedeutung«, ist dafür aber umso assoziativer. Ich glaube kaum, dass zwei Menschen dieselbe Musik hören können. Aber gut, das mag bei einem Gedicht ähnlich sein, dass es in jedem Menschen anders anklingt.
Sie sind selber Schriftsteller und Drehbuchautor. Ein anderer Schriftsteller, Peter Handke, ist mit Ihrem Werk eng verbunden, er hat eine eigene Art von »Kunst-Religion« geschaffen. Wie erleben Sie Handkes Literatur?
Peters Bücher bedeuten mir mehr als die aller anderen zeitgenössischen Autoren. Ich bin keinem anderen Schriftsteller so nah gewesen, seit ich selbst angefangen habe zu arbeiten, oder habe mit niemand anderem so ein »paralleles« Lebensgefühl gehabt. Ich freue mich riesig auf jedes neue Buch wie auf einen Meilenstein. Es ist schade, dass viele Leute eine Scheu haben, sich auf Peters Schreiben einzulassen. Und, ja, man muss sich darauf einlassen, damit es aufblühen kann. Aber wenn man es tut, kriegt man ungeheuer viel zurück. Peter »investiert« ungemein viel Erfahrung, Beobachtung, Lebenszeit, Weisheit und Menschenkenntnis in seine Bücher. Letzten Endes ist das beim Filmemachen – oder auch beim Songschreiben – genau dasselbe: Nur, wenn man viel von sich selber investiert, kann auch der Leser, Hörer, Zuschauer viel empfangen.
Viel von sich selber zu investieren, heißt immer auch, sich zu offenbaren, zu entbergen. Das Unverborgene, die aletheia, ist das griechische Wort für Wahrheit. Als Dokumentarfilmer, aber auch als Autor fiktionaler Filme: Was ist für Sie Wahrheit im Film, was verstehen Sie unter Wahrhaftigkeit?
»Wahr« hat so wie das englische »true« vier Buchstaben und ist in den Zeiten von »alternativen Fakten« zu so etwas wie einem Unwort geworden, wofür es im englischen Sprachgebrauch den Ausdruck »four-letter-word« gibt. Gut, der Begriff ist für Schimpfworte geprägt worden, aber genau dazu sind diese Worte wie »real«, »true«, »good« und eben »wahr« ja auch verkommen. Das will ja niemand mehr in den Mund nehmen. Ist «Wahrheit« nicht gerade im öffentlichen Leben komplett beliebig geworden? In einer Zeit, in der es ein Pendant dazu gibt, die »alternativen Fakten«? Ich mag deswegen ihr schönes deutsches Wort »Wahrhaftigkeit« viel lieber! Dahin führt durchaus noch ein Weg, gerade in meinem Beruf oder Handwerk des Filmemachens. Das mag im Dokumentarfilmbereich mehr auf der Hand liegen als in Spielfilmen, aber in beiden Gattungen gibt es sowohl ein Lügen als auch ein Weglassen von Wahrheit als auch eine fortwährende Suche nach ihr. »Wahrhaftigkeit« bezeichnet doch vor allem ein Streben nach etwas Wahrem, den ständigen Versuch, ihm nahe zu kommen. Weil man davon ausgeht, dass es das gibt, ein Wahres. Auch in einer Geschichte. Dabei meine ich nicht den gerade im Kino so beliebten Ausdruck, etwas sei »nach einer wahren Geschichte« verfilmt. Wenn ich das vor einem Film lese, habe ich immer gleich die größten Bedenken, was seinen möglichen Wahrheitsgehalt angeht, wenn ich nicht eh gleich lauthals lachen muss. Diese entweder tautologische oder sich selbst ausschließende Definition steht ja allzu oft nur da, um einer beliebigen Fiktion »Glaubwürdigkeit« zu verleihen. Da ist jetzt noch so ein schönes deutsches Wort im Spiel: Wann ist etwas »glaub-würdig«? Wenn es von »Wahrhaftigkeit« zeugt, also Wahrheit an ihm haftet? Man könnte von hier ausgehend seitenlange Definitionen schreiben. Für mein Teil glaube ich, dass auch Geschichten, also pure Fiktion, die man sich ausgedacht hat, einen Grad von Wahrhaftigkeit haben können, so dass die Charaktere darin durchaus »glaubhaft« sein können, mitunter sogar »wahrer« werden können als Personen in Dokumentarfilmen, denen man ja a priori »Glaubhaftigkeit« nachsagen will, von denen ich aber nur zu genau weiß, wie gerne sich da hinter dem Mantel des Dokumentarischen durchaus Geflunkertes und Halbwahres verbergen kann. Wie wahrhaftig ein Mensch oder eine Figur in einem Film ist, das kann man ja nur ahnen, nicht wissen. Ein Wissen davon wäre erst aus der Summe eines Lebens abzulesen. So wie im Falle von Hans Ehrenberg, eines wahrhaft »wahrhaftigen« Menschen. Aber jetzt reden wir darüber, wie erst Taten den Worten wirklich »Wahrhaftigkeit« verleihen.
Und wenn Sie nun den Auftrag erhielten oder ihn sich selber gäben, die Geschichte von Hans Ehrenberg zu verfilmen, wie würden Sie ansetzen?
Ich würde mich erst mal mehr in sein Leben vertiefen als ich dazu bislang in der Lage war. Ich würde versuchen, so viel wie möglich von seinen Schriften zu lesen, vor allem die späten. Und dann ist die Geschichte dieses jüdisch-stämmigen deutschen Protestanten, Philosophen und Arbeiterpfarrers so sehr mit der Deutschen Geschichte verbunden und spannt sich so aufregend vom Ersten Weltkrieg über Widerstand, Verhaftung und Asyl bis in die Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit, dass ich das schon als eine große Metapher für dieses Land inszenieren würde. Mit einem »Helden«, wie man sich so viele mehr gewünscht hätte. Und ich denke, ich würde die Geschichte in der Mitte seines Lebens beginnen. Da, wo dieser Mann in seinem 40. Lebensjahr von vorne angefangen hat und da erst beginnt, Theologie zu studieren. Von da aus seine nimmermüden Bemühungen um ein Verständnis zwischen jüdischem und christlichem Glauben zu erzählen, das wäre ein guter Ansatz, denke ich.
—
Wilhelm (»Wim«) Ernst Wenders, geboren 1945 in Düsseldorf 1966 zunächst erfolglos nach Paris an die Filmhochschule IDHEC, dann Studienbeginn an der neugegründeten Hochschule für Fernsehen und Film in München. Studienabschluss 1970 mit »Summer in the City«. 1971 Mitgründer des Verlags der Autoren und Verfilmung von Peter Handkes Roman »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter«, 1978 Hollywooddebüt mit »Hammett«. 2006 Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz, 2014 mit dem »Goldenen Ehrenbären« bei den 65. Internationalen Filmfestspielen in Berlin als Hommage an sein Schaffen. Gemeinsam mit Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Volker Schlöndorff und Edgar Reitz gehört er zu den bedeutendsten Personen des deutschen Films und zum wesentlichen Bestandteil jener jungen Generation von Filmemachern, die den »Neuen Deutschen Film» in den 1970er Jahren maßgeblich geprägt haben.
—
Filme (Auswahl) – 1970 Summer in the City – 1972 Die Angst des Tormanns beim Elfmeter – 1974 Alice in den Städten – 1977 Der amerikanische Freund – 1982 Hammett – 1984 Paris, Texas – 1987 Der Himmel über Berlin – 1991 Bis ans Ende der Welt – 1993 In weiter Ferne, so nah! – 1994 Lisbon Story – 2000 The Million Dollar Hotel – 2002 Viel passiert – Der BAP Film – 2005 Don’t Come Knocking – 2008 Palermo Shooting – 2011 Pina – 2014 Das Salz der Erde – 2015 Every Thing Will Be Fine – 2017 Submergence

Wim Wenders und Carrie Fisher bei einer Veranstaltung Anlässlich einer Filmpremiere, 1978 (Foto: Alan Light)

Wim Wenders bei der Vorstellung seines Spielfilms »Palermo Shooting« im Mannheimer Cineplex, 2008 (Foto: Smalltown Boy)