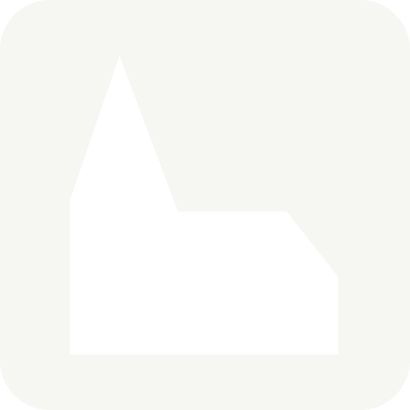Reformation 2017. Eine Bilanz
Johann Hinrich Claussen, Stefan Rhein (Hrsg.)
Reformation 2017. Eine Bilanz
edition chrismon Flexibles Hardcover 192 Seiten, 23 x 29 cm ISBN 978-3-96038-082-5 EUR 24,00
Zu bestellen per E-Mail an das Kulturbüro der EKD oder den Verlag edition chrismon.
Initiiert durch das Kulturbüro des Rates der EKD und die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt reflektiert dieser Band, unter anderem mit einem der letzten publizistischen Beiträge Heiner Geißlers, die Aktivitäten und das Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten der »Lutherdekade« und des Reformationsjubiläums 2017. Was ist gelungen? Was bleibt? Und was bleibt vielleicht offen? Welche Lehren lassen sich für unsere Gedenkkultur und die Zusammenarbeit von Staat, Kirche und Zivilgesellschaft ziehen?
Autoren: Clemens W. Bethge, Sigrid Bias-Engels, Johann Hinrich Claussen, Christoph Dieckmann, Sebastian Duda, Matthias Drobinski, Heiner Geißler, Benjamin Hasselhorn, Andreas Hillger, Claudia Janssen, Gottfried Knapp, Christhard Läpple, Dirk Pilz, Sandra Reimann, Stefan Rhein, Peter Riesbeck, Stephan Schaede, Jürgen Tietz und Olaf Zimmermann
Themen: Deutschland, einig Lutherland? Zusammen arbeiten – Miteinander feiern Das Fremde vermitteln Luthergedenken mit Frauen? Im Anfang war die Zahl Bürgerschaftliches Reformationsgedenken? Dazu viele Fotos und ein Blick auf die publizistische, künstlerische und bauliche Ernte des Reformationsjubiläums.
Aus dem Vorwort der Herausgeber: Feste soll man nicht nur feiern, wie sie fallen. Man muss sie auch nachklingen lassen. Wenn der letzte Gast gegangen ist, beginnt man aufzuräumen. Man sinnt dem fröhlichen Lärm hinterher, wischt durch, resümiert, mit wem man gesprochen oder getanzt hat und mit wem nicht, wäscht und trocknet ab, zählt nach, wer gekommen ist oder gefehlt hat. In den Tagen danach spricht man mit der oder dem, wie es so gefallen hat, welche Geschichten es noch zu erzählen gibt und ob eigentlich jemand daran gedacht hat, Fotos zu machen. Es ist gut, nach einem großen Fest nicht sofort wieder in den Alltag zu eilen, sondern das Erlebte und Genossene in eigenen Gedanken und im Gespräch mit anderen zu sichten und für die Zukunft aufzubewahren. Dabei zieht man unweigerlich Bilanz. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Ist es so geworden, wie man es sich gewünscht hat? Hat man erreicht, was man sich vorgenommen hat? Was hat es gebracht? Würde man es wieder machen?
Das Reformationsjubiläum 2017 war ein großes Fest und anspruchsvolles Unternehmen. Es wird für lange Zeit die bedeutendste Gedenkfeier in Deutschland gewesen sein. Auch wem der Luther-Rummel an den Nerven gezerrt hat oder wer sich für das Christentum nicht sonderlich interessiert, wird nicht leugnen können, dass es so bald kein vergleichbares kulturelles Großereignis geben wird. Das hat sein tieferes Recht. Denn – was nur wenige wissen – unsere heutige Erinnerungskultur verdankt sich nicht zuletzt auch der Reformation. Was wir als öffentlich begangenes Geschichtsgedenken kennen, ist eine Spätfolge des frühen Protestantismus. Die erste Jahrhundertfeier des sogenannten Thesenanschlags im Jahr 1617 setzte ganz bewusst die historische Memoria an die Stelle der Jubeljahre, die die Papstkirche für ihre Ablässe inszenierte. Nicht ein frommer Handel, sondern die dankbare Erinnerung an ein beglückendes Ereignis sollte gefeiert werden. Die heutigen Gedenkfeiern für Kriegsanfänge und Friedensschlüsse, epochale Menschheitsverbrechen und humane Neuaufbrüche, aber auch familiäre Erinnerungsfeiern wie besondere Geburtstage oder Goldene Hochzeiten, verdanken sich – unbewusst – den ersten protestantischen Reformationsjubiläen.
»2017« steht also in einer langen Tradition und sollte zugleich in einem neuen Geist gefeiert werden. Viele und sehr unterschiedliche Akteure haben dazu beigetragen: staatliche Institutionen, die Kirchen in ihren unterschiedlichen Gliederungen, Vertreter der Zivilgesellschaft und Kultureinrichtungen. Was ist gemeinsam gelungen oder auch nicht? Es lohnt, schon auf den letzten Metern eine erste Rückschau zu versuchen. Eine letztgültige Bilanz wird schwerlich gelingen. Dafür ist zu viel geschehen, dafür sind die Folgen noch zu undeutlich. Aber eine Bilanz sollte man schon wagen. Das liegt in der Sache selbst begründet. Die Reformation fordert noch immer zu einer eigenen Stellungnahme heraus, und ihr aktuelles Jubiläum war bewusst darauf angelegt, eine heutige Auseinandersetzung mit diesem historischen Ursprung anzuregen. Was hat sich dabei gezeigt? Besonders dringlich wird diese Frage dadurch, dass sich in die Festfreude unüberhörbar auch eine gute Portion Unsicherheit, Irritation und Zukunftssorge gemischt hat.
Mit diesem Buch versuchen wir, ohne Unfehlbarkeitsanspruch eine erste Bilanz zu ziehen. Verantwortet wird sie von der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und dem Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland, das heißt einem staatlichen und einem kirchlichen Akteur des Jubiläumsgeschehens, was auch ein Beleg der vertrauensvoll-offenen Zusammenarbeit von Staat, Kirche und Kultur im Jubiläumsjahr und in der vorbereitenden Dekade darstellt. Für wichtige Aspekte des Jubiläums haben wir Autorinnen und Autoren gebeten, ihren fachlichen und zugleich persönlichen Blick auf dieses Fest zu werfen und ein erstes Urteil darüber zu bilden, was hier gelungen oder misslungen ist, was bald vergessen sein wird oder was weiterwirken könnte. Eine amtliche Kassenprüfung wird dies nicht ergeben, wohl aber ein Mosaik aus verschiedenen Versuchen eines möglichst ehrlichen und unbefangenen Nachdenkens, für das Dankbarkeit und Kritik keine Gegensätze darstellen. Vollständigkeit wird dabei nicht angestrebt, sie ist hier auch gar nicht möglich. So können zum Beispiel die ungezählten regionalen, lokalen und internationalen Aktivitäten nicht in ihrer Fülle vorgestellt werden. Aber manchmal regt gerade ein unvollständiges Bild den Betrachtenden dazu an, es für sich selbst weiter auszumalen.
Offen bleibt notwendigerweise die Frage nach dem Kriterium. Woran soll das Gelingen oder Misslingen gemessen werden: an den Zahlen der Gäste oder an der Resonanz in den Medien? Martin Luther hat dem Protestantismus eine tiefe Skepsis gegenüber dem Prinzip »Erfolg« eingeimpft. Bereits zur Eröffnung der Lutherdekade am 21. September 2008 wurde dieser Gedanke Luthers über das Leben des Menschen zitiert und blieb die folgende Jahre präsent und bewusst: »Es ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber in Gang und Schwung. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.«
Diese theologische Relativierung von Erfolg hat ihr gutes Recht; sie kann heute jeder und jedem zu denken geben. Aber natürlich, wenn so viel Mühe und auch Mittel in eine deutschlandweite, ja deutlich darüber hinaus gehende Jubiläumsfeier geflossen sind, muss man Rechenschaft darüber geben, was funktioniert hat und was nicht – und warum. Dem auf die Spur zu kommen, versuchen die Textbeiträge dieses Buches. Aber nicht nur sie. Mit einer traditionell durchaus untypischen protestantischen Freude am Bild geben viele Fotos ein assoziationsträchtiges Zeugnis von den unterschiedlichsten Ereignissen dieses besonderen Jahres. Sie mögen Ihnen Anregung sein, Ihre eigene Bilanz zu ziehen.
Klaus-Martin Bresgott