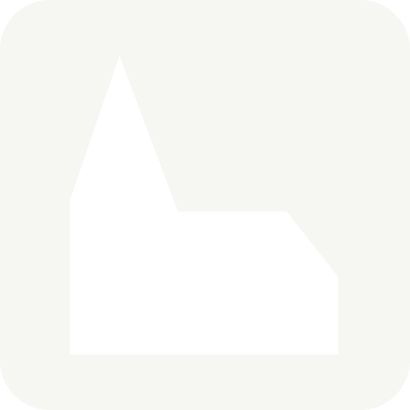Heinrich Böll: Nicht nur zur Weihnachtszeit
Heinrich Böll »Nicht nur zur Weihnachtszeit«
Heinrich Böll: Nicht nur zur Weihnachtszeit
1952 erscheint eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll unter dem Titel »Nicht nur zur Weihnachtszeit«. Schon die literarische Form lässt aufhorchen, hatte Böll damals doch etwas ganz und gar Ungewöhnliches, ja Provozierendes riskiert: eine Satire auf das deutsche Weihnachten. »Nicht nur zur Weihnachtszeit« ist mittlerweile sprichwörtlich geworden, wenn es darum geht, eine Fest-Stimmung künstlich zu konservieren auch über den betreffenden Anlass hinaus. Die Geschichte gehört schon aus literarischen Gründen zum Besten, was Böll in den fünfziger Jahren zur Mentalitätsgeschichte Nachkriegsdeutschlands geschrieben hat. Keine Anweisung ans Publikum, kein didaktischer Zeigefinger. Keine moralische Belehrung. Stattdessen ein brillanter Text von schriller Komik, erzählt von einem konservativen, ja eher spießigen Familienmitglied, das, völlig irritiert und sichtlich um Fassung bemüht, über »Verfallserscheinungen« berichtet, die sich in der Familie seines Onkels Franz, einem ehrbaren Kaufmann, abgespielt haben.
Alles fängt in der Familie des ehrbaren und zugleich »herzensguten« Obst- und Gemüsehändlers Franz damit an, dass die vielen Luftangriffe während des Krieges es der Familie verunmöglicht haben, wie gewohnt ihren Weihnachtsbaum aufzustellen, worunter vor allem »Tante Milla« entsetzlich zu leiden beginnt. Denn der traditionelle Weihnachtsbaum hatte stets eine besondere Attraktion aufzuweisen: einen Mechanismus, mit dem 12 gläserne Zwerge, nachdem man ihnen mit Hilfe von Kerzen unter ihren Fußsohlen die nötige Wärme zugeführt hatte, mit einem Korkhammer auf glockenförmige Ambosse einschlagen können. Das dabei erzeugte Geräusch gleicht einem »konzertanten, elfenhaft feinen Gebimmel«. Überdies hatte an der Spitze des besagten Tannenbaums »ein silbrig gekleideter rotwangiger Engel« gehangen, »der in bestimmten Abständen seine Lippen« zu heben »und ‚Frieden, Frieden’« zu flüstern imstande ist. Nicht zu reden von dem üblichen Christbaumschmuck, der selbstverständlich auch an diesem Tannenbaum nicht fehlt, bestehend aus Zuckergekringel, Gebäck, Engelhaar, Marzipanfiguren und Lametta. Doch die Kriegseinwirkungen waren derart gewesen, dass Tante Milla »nach harten Kämpfen, endlosen Disputen, nach Tränen und Szenen sich bereit erklären musste, für die Kriegsdauer auf ihren Baum zu verzichten.«
Das ändert sich schlagartig nach Ende des Krieges, denn Tante Milla verlangt jetzt energisch ihren Baum zurück. Weihnachten 45 ist an den üblichen Christbaum-Schmuck noch nicht zu denken, aber Weihnachten 46 ist wieder alles beisammen, zumal über den Krieg »eine komplette Garnitur von Zwergen und Ambossen sowie ein Engel erhalten geblieben« ist. Also kann Weihnachten wie eh und je begangen werden, und alles wäre in bester Ordnung, hätte nicht ein Umstand alles verändert. Als Anfang Februar 1947 die Zeit gekommen ist, in der man Christbäume abzubauen und zu entsorgen pflegt und man sich in der Familie anschickt, genau das zu tun, reagiert Tante Milla unerwartet: Sie verfällt einem nicht enden wollenden entsetzlichen Schreikrampf. Nichts hilft, um dieses Schreien zu stoppen. Kein Neurologe weiß Rat, kein Psychiater kann helfen, keine Diagnose schafft Aufklärung, bis Onkel Franz die rettende Idee hat. Er stellt einen neuen Tannenbaum auf. Zwar rettet diese »Tannenbaumtherapie« die Situation und die Schreie können gestoppt werden, aber Tante Milla verlangt mehr, sanft, aber unerbittlich. Wenn schon Tannenbaum, dann auch Weihnachtsfeier und zwar mit dem üblichen Personal: mit Kindern, Enkeln und dem örtlichen Pfarrer. So gehen Wochen ins Land. Karneval kommt, der Frühling bricht an, aber Tante Milla wehrt jeden Versuch, den Weihnachtsbaum abzubauen mit so heftigem Geschrei ab, dass man die Zwerge sofort wieder komplettiert, die Kerzen anzündet und etwas hastig, aber sehr laut in das Lied ‚Stille Nacht’ ausbricht. Die Weihnachtsfeier? Sie ist zur Falle geworden! Das Weihnachtszimmer zum Schreckensszenario.
Auf Dauer aber schafft dies nicht unerhebliche logistische Probleme und zwar bezüglich Ausstattung und Personal. Woher ganzjährig einen Tannenbaum nehmen? Woher die Süßigkeiten bekommen, die im Sommer wegzuschmelzen drohen? Noch prekärer ist die Situation beim Personal. Ende Juni entschuldigt sich der Pfarrer und wird durch den örtlichen Kaplan ersetzt. Der aber bekommt schon am ersten Abend einen solchen Lachanfall, dass er den Raum verlässt und nie mehr gesehen wird. Man hat Glück: Ein pensionierter Prälat aus der Nachbarschaft kann einspringen. Fortan spielt er seine Rolle vorzüglich. In der Familie selber aber kommt es zu ersten Zerrüttungen. Cousine Lucie, »bisher eine normale Frau«, wie es ausdrücklich heißt, erleidet einen Nervenzusammenbruch. Ein »Spekulatiustrauma« lässt sie aggressiv werden, so dass sie mit einer Zwangsjacke abgeführt werden muss. Ihr Ehemann Karl sondiert bereits Auswanderungspläne und zwar in ein Land, wo keine Tannenbäume wachsen, die Herstellung von Spekulatius unbekannt und das Singen von Weihnachtsliedern verboten ist. Vetter Johannes, ein erfolgreicher Rechtsanwalt und bisher Lieblingssohn des Onkels, tritt zuerst aus seinem Gesangverein »Virhymnia« aus, weil er »an der Pflege des deutschen Liedgutes« nicht mehr teilnehmen kann. Später schließt er sich der Kommunistischen Partei an. Sein Bruch mit der Familie ist endgültig. Und der selbstlose, herzensgute Onkel Franz, bisher Muster eines guten Gatten und vorbildlichen Christen? Selbst er gerät auf die schiefe Bahn und legt sich »trotz seines hohen Alters eine Geliebte« zu.
Doch die Weihnachtsfeier geht weiter, unerbittlich, gnadenlos. Sie kann weitergehen, weil man auf die – so der Erzähler – »grässliche Idee« gekommen war, die Familienmitglieder durch Schauspieler zu ersetzen. Onkel Franz finanziert ab jetzt »ein kleines Ensemble«, das Johannes, Karl und Lucie ersetzt, allerdings unter der Voraussetzung, dass immer einer aus der Familie »im Original an der abendlichen Feier teilzunehmen hat, damit die Kinder in Schach gehalten werden.« Man hat Glück: Weder Tante Milla noch der Prälat merken etwas von diesem »frommen Betrug«. Und sie merken auch nichts, als in der nächsten Phase die Kinder – sie dem abendlichen Ritual weiter auszusetzen wäre verantwortungslos gewesen – durch »Wachspuppen« ersetzt werden.
Satire auf das deutscheste aller deutschen Feste ist man im Nachkriegsdeutschland nicht gewohnt. Dass man in deutscher Nachkriegsgesellschaft vielfach weitergemacht hat, als wäre nichts geschehen, will man sich nicht widerspiegeln lassen. Dass das christliche Weihnachten oft genug zum leeren Ritual erstarrt ist, will man nicht sehen. Die Geschichte löst denn auch eine öffentliche Kontroverse aus. Böll sieht sich herausgefordert. Seine »Weihnachtszeit« habe »einigen Staub aufgewirbelt«, schreibt er einem Briefpartner im Januar 1953. Der evangelische Pressedienst habe einen »sehr kritischen Brief« an ihn veröffentlicht; man sei »doch sehr gekränkt«. Ja, Böll nimmt die Sache so ernst, dass er seinerseits mit einem Offenen Brief antwortet. Zum Hauptpunkt führt er aus: »Natürlich ging es mir nicht um den klinischen Fall ‚Tante Milla’, ging es mir nicht darum, die christliche Weihnachtsbotschaft zu diffamieren, ganz im Gegenteil: Es ging mir um den unerträglichen äußeren Betrieb, der darum gemacht wird, der jedem menschlichen Gefühl widerspricht und der um des Geschäftes willen gemacht wird. Mit dem deutschen Gemüt lässt sich ein großartiges Geschäft machen, und wer so in der Adventszeit durch die Straßen einer Großstadt schlendert, dem kann wirklich bange werden, und es wäre zu empfehlen, den Schuhe, den Seife, den Schokolade anbietenden Engeln ein Spruchband in den Mund zu hängen mit dem Wort des großen Christen Chesterton: ‚Reklame ist die Bettelei der Reichen. Kauf Y heißt: Gebt mir mehr Geld, gebt mir noch mehr Geld, als ich schon habe.’ Stellen Sie sich vor, sehr geehrter Herr Pfarrer, einen Advent ohne Reklame! Das müsste wirklich etwas wie Frieden in den Straßen unserer Städte sein.«
Es lohnt sich, den Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll als brillanten Satiriker, scharfen Zeitkritiker und ebenso sensiblen christlichen Denker gegen ein etabliertes Kirchenchristentum wiederzuentdecken und neu zu lesen. Auf seinen 100. Geburtstag im Dezember 2017 hin laden Romane wie »Ansichten eines Clowns« oder »und sagte kein einziges Wort« ein, einen Schriftsteller zu hören, der einst für sich bemerkte: "Mir scheint die Trennung des Jesus vom Christus wie ein unerlaubter Trick, mit dem man dem Menschgewordenen seine Göttlichkeit nimmt und damit auch allen Menschen, die noch auf ihre Menschwerdung warten ... An der Gegenwart des Menschgewordenen werde ich nie zweifeln. Aber Jesus allein? Das ist mir zu vage, zu sentimental, zu storyhaft, zu sehr eine rührende 'Geschichte'… So kann ich mich weder Christ nennen noch Anhänger des Jesus von Nazaret sein. Ich kann nur an die Präsenz des Menschgewordenen glauben. Nicht mehr und nicht weniger." Im Roman »und sagte kein einziges Wort«, der als der literarische Durchbruch Heinrich Bölls gilt, erscheint der Menschgewordene als Deutungsfigur einer Frau, die um ihre Menschwerdung kämpft. Von daher wird auch klar, warum Böll nicht an einer Trennung von Jesus und Christus interessiert sein kann, warum er Göttliches und Menschliches nicht auseinanderzureißen vermag. Das Göttliche vom Menschlichen trennen hieße, die Hoffnung all derer zunichte zu machen, die ihre Menschwerdung noch vor sich haben. Ohne das Göttliche wäre die Hoffnung auf Menschwerdung nicht allumfassend, nicht letztlich begründet. Und ohne das Menschliche wäre das Göttliche ein freischwebender Überbau über der Wirklichkeit. Indem beides aufeinander bezogen wird, kann das Versprechen definitiver Menschwerdung eingeklagt werden. Menschwerdung ist eine Verheißung, die der Erfüllung bedarf. Und weil diese Menschwerdung für ungezählte Menschen noch aussteht, ja täglich von Christen und christlichen Institutionen verhindert wird, kann Böll sagen, die Menschwerdung des Menschen habe wahrscheinlich noch nicht begonnen. Und ebenso auch: »Wahrscheinlich hat das Christliche noch nicht begonnen.« Äußerungen aus Bölls Frankfurter Poetik-Vorlesungen, an die in diesem Jahr erinnert und die in diesem Jahr ihren besonderen Platz haben können.
Karl-Josef Kuschel