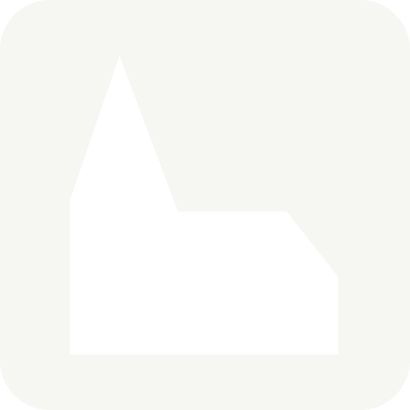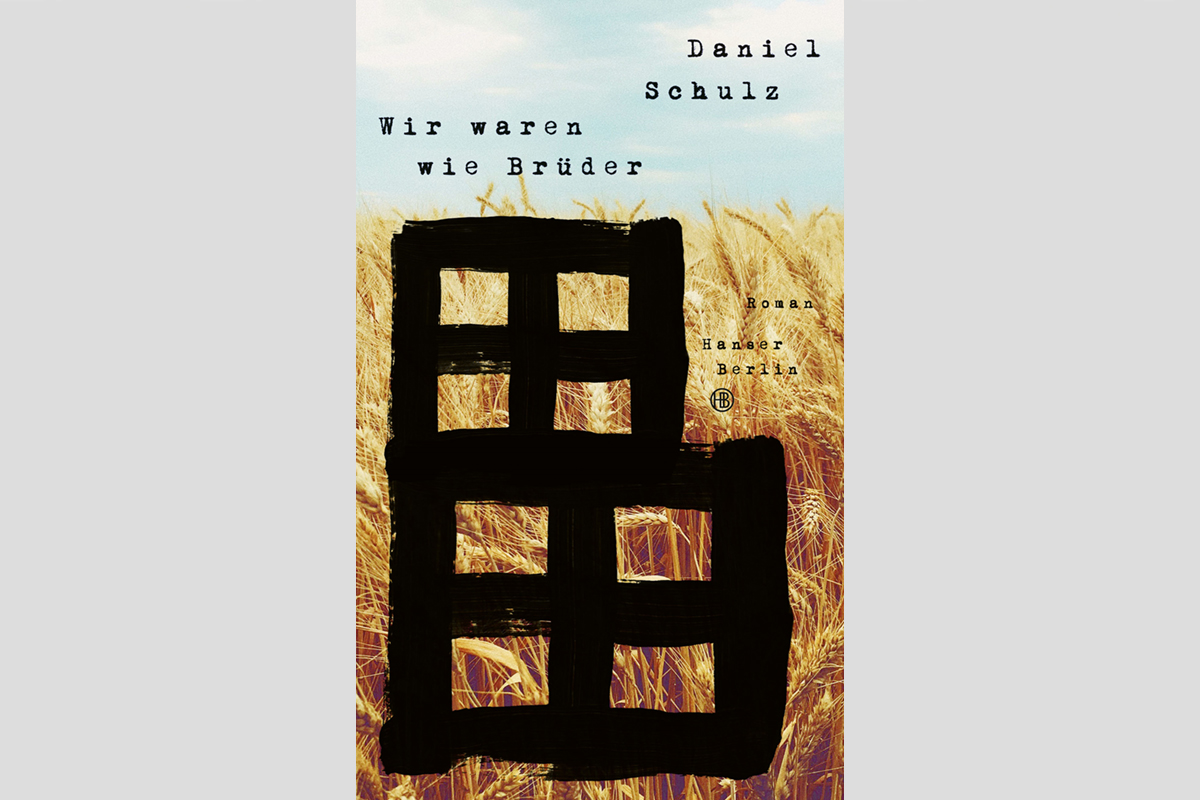Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder
Belletristik · Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder
Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder
Hanser Berlin, 2022 288 Seiten 23 Euro
Was Gerhard Schöne 1992 in »Die zurückgelassenen Kinder« mit »Schnauze voll und Augen leer« als adoleszentes Lebensgefühl der Alleingelassenen beschreibt, führt Daniel Schulz in seinem Romandebüt am Beispiel der brandenburgischen Provinz vor – in den ersten Jahren des neuen Deutschland, mit denselben Leuten bei veränderter politischer Gemengelage – grandios direkt, satzweise changierend zwischen Verstörung und Vertrautheit. Als Ich-Erzähler, im Präsens. Zehn, als die Mauer fällt. Am Abgrund aller eingeimpften, für die Kindheit existenziellen Gewissheiten, die peu à peu über Bord gehen, obgleich diese zwischen Ernst Thälmann und Jesus viel zulassen Dank Vati im gehobenen NVA-Dienst und Mutti, stark kirchlich sozialisiert, tätig in der LPG. Diese elterliche Kombination stößt ziemlich skurril auf, ist aber auch das einzige, was fiktional klingt. Der Rest – ja: der ganze pralle Rest atmet tatsächlich so viel Wirklichkeit, dass einem schwindlig wird und ist dabei so pointiert und geistreich buchstabiert, wie es ein gutes Buch nur sein kann. Daniel Schulz agiert stilistisch nahe am Werther. In kurzen, tagebuchähnlichen Eintragungen nimmt er uns von 1989 bis 2000 mit in den Plattenbau am Dorfrand, gleich neben die Felder der LPG (P). Sein Ich ist die tragende Figur, die das krakenhafte Mäandern des eigene Erwachsenwerdens im Dämmern der brandenburgischen Provinz ertragen und durchstehen muss, umgeben von jener janusköpfigen Wirklichkeit, wie sie Anfang des Jahres erst die ARD-Mini-Serie ZERV unterhaltsam augenöffnend ins Fernsehen gebracht hat. Wie erlebt man die, wenn man 10 ist? Wenn die Imperialisten, vor denen in der Schule täglich gewarnt wurde, das eigene Land lächelnd einnehmen, Eigentum zurückfordern, Arbeitsplätze einstampfen, elterliche Bildung und Erfahrung für wertlos erklären? Und wenn dann nicht nur Opa von letzten Heldentaten als deutscher Soldat prahlt, sondern bald auch die Freunde ringsum selbst solche sein wollen, die Reichskriegsflagge hissen und glauben, der Trostlosigkeit der plötzlich doppelt abgehängten Provinz nur entrinnen zu können, indem sie Fremdes aussieben, sich darüber erheben und hermachen? Mit verbalen Exzessen, mit körperlicher Gewalt. Mittendrin also Ich – eingebunden in die Familie, die das Einzelkind umhegt, aber oft genug sich selbst überlässt – oft entscheidungsunfähig, wofür Mariam die kirchliche Sozialisation verantwortlich macht »Du stellst dich bei keinem richtig dazu … Immer nur dazwischen.« Dabei ist ein Standpunkt wichtig. Wie im Klassenkampf. Freund oder Feind. Willkommen auf dem Weg zum Krieger! In ihrem Gefolge hat man nichts zu befürchten. Aber nur ihr Gefolge sein, reicht auch nicht so richtig. Mariam wird über die Zeit die prägendste Figur. Sie stammt aus Georgien und ist cool: angstfrei und souverän. Sie ist angehimmelte Klassenkameradin, wichtige Gesprächspartnerin und schließlich erste große Liebe, wie sie Udo Lindenberg in »Meine erste Liebe« beschreibt, wenn auch alles nach außen stiller und provinzieller abläuft. Mit einer Sprache, die sich jeder Langatmigkeit entledigt und dabei ein untrügliches Gefühl für Rhythmik und Phrasierung hat, gelingt es Daniel Schulz, die aus Langeweile zwischen den Häuserblocks und im Bushäuschen wartend gedeihende, wuchernde Wut zu beschreiben, die sich erst am PC im Ballerspiel und später mit dem Baseballschläger in der Hand exzessiv Bahn bricht. Wut auf die Verlogenheit des alten, Wut auf die Verlogenheit des neuen. Wut gegen die eigene Ohnmacht, die keiner haben will. Schonungslos, aber mit großer Empathie zeigt das Buch ein immergleiches Dilemma: das Desinteresse an wirklicher Auseinandersetzung mit den Ursachen von Rassismus in fehlender gesellschaftlicher Empathie, kultureller Bildung und positiver Autorität. Daniel Schulz richtet einen starken Scheinwerfer darauf.
Klaus-Martin Bresgott