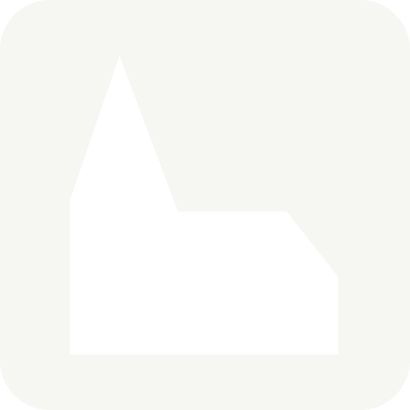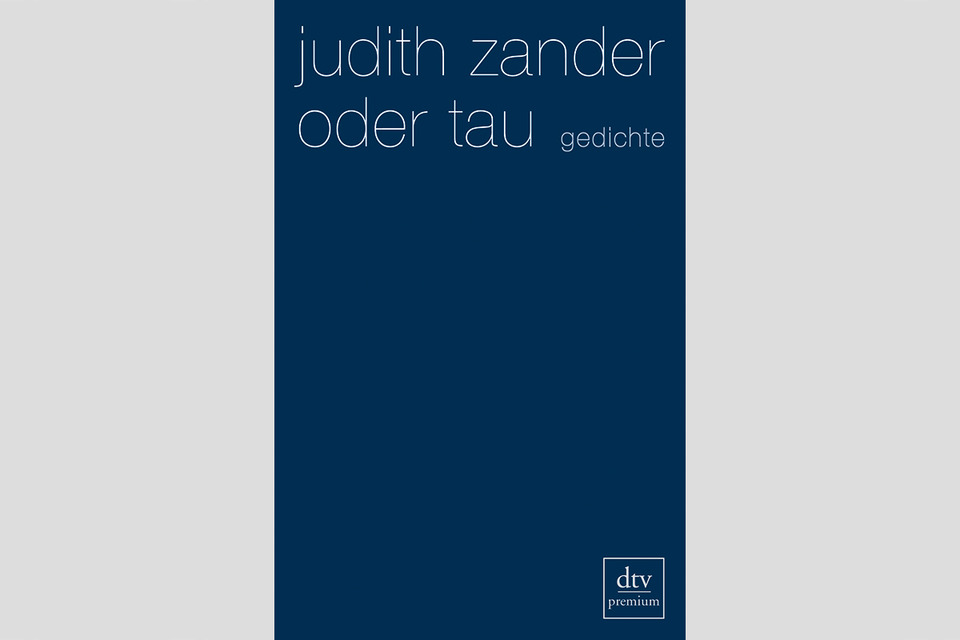Judith Zander – Schriftstellerin
Ich schreibe, weil es mir Freude macht
Judith Zander – Schriftstellerin
Ich schreibe, weil es mir Freude macht
»Uns verbindet, was wir einander verschweigen« ist einer der vielen, wie beiläufig Wirklichkeit prognostizierenden Aufhorchsätze, mit denen sich Judith Zander durch ihren Debütroman »Dinge, die wir heute sagten«, der gleich auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises zu finden war, in die Öffentlichkeit hinein geschrieben hat. Folgt man ihren Spuren, mit denen sie der Wanderdüne der Wörter folgt und diese auf ihre Tauglichkeit zur Aussage und ihre Wertigkeit zwischen uns hin prüft, gerät man an eine Frau, der das Wortspiel schönster Ernst ist.
Was bewegt Sie zu schreiben? Ist es eine Lust oder eine Notwendigkeit? Beides. Ich schreibe, weil es mir Freude macht, wenn mir mit den Mitteln und Möglichkeiten der Sprache gelingt, etwas Beobachtetes, Imaginiertes oder Empfundenes, meistens ist es ja alles zugleich, zum Ausdruck zu bringen, so genau und »wahr« wie möglich zu fassen. Und ich merke, dass eine gewisse Unruhe oder ein Ungenügen an der Welt und an mir selbst wächst, wenn ich dies länger nicht tue. Das muss aber nicht immer literarisches Schreiben sein. Ich habe einfach eine große Affinität zur Schriftlichkeit und fühle mich darin mehr zu Hause als in der mündlichen Rede, bei der ich oft das Gefühl habe, zu schnell, zu unbedacht reagieren zu müssen und überflüssige Dinge zu sagen. Nicht, dass das beim Schreiben nicht auch passierte, die Sprachfähigkeit ist sehr verführerisch. Und manchmal ist eben einfach die Lust an der Formulierung der einzige Grund für eine Äußerung. Das mag eine Art Berufskrankheit sein.
Ziehen sich fixe Themen durch Ihr Werk? Wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich bin ich selbst auch zu nah dran, um sie genau ausmachen zu können. Mich beschäftigt grundsätzlich das Innenleben der Menschen, eine Art psychologischer oder seelischer Wahrheit ganz im Sinne des »Anton Reiser«, und wie sich diese jeweilige Verfasstheit auf den Umgang mit anderen Menschen auswirkt. Das sage ich als eher menschenscheuer Mensch, der in beständiger Ambivalenz lebt zwischen der Faszination für das Dasein und dem Fluchtimpuls vor diesem. Weshalb vor allem auch in den Gedichten die Menschenleere eine wichtige Rolle spielt, also die sogenannte Natur. Das Alleinsein und das Alleinseinkönnen mit sich. Aber das sind natürlich nicht nur Schreib-, sondern Lebensthemen.
Welche Verbindung gehen Wort und Musik ein? Wie würden Sie sie beschreiben? Meine Erfahrungen mit dieser Verbindung sind, was meine eigenen Worte angeht, gering oder eigentlich nicht vorhanden, wenn von tatsächlicher Musik die Rede ist. Die Musikalität der Sprache ist etwas anderes und für mich, gerade was Rhythmus und Lautlichkeit / Klang angeht, sehr wichtig. Songtexte lerne ich oft ohne es zu merken auswendig und singe alles Mögliche mit – auch auf einer eher trivialen Ebene können sich Musik und Text zu etwas Erhebendem zusammenfügen. Das funktioniert immer dann, wenn das eine nicht gut ohne das andere auskommt, sie sozusagen amalgamieren zu einer höheren Einheit. Zwei der großartigsten und unausschöpflichsten Beispiele sind sicherlich die »Winterreise« und »Die schöne Müllerin« – Wilhelm Müllers eher einfache, beinahe sentimentale Gedichtzyklen wären womöglich vergessen, hätte Schubert sie mit seinen Vertonungen – wofür sich eben gerade ihre Einfachheit, quasi Unvollkommenheit im Sinne von Unvollständigkeit so gut eignete – nicht auf eine höhere Stufe gehoben. Nun aber sind es in diesen Schubertschen Liederzyklen gerade die Texte, die die Musik mit Leben, mit zutiefst berührenden Bildern und einer Geschichte füllen.
Gibt es eine Musik, der Sie sich verbunden fühlen? Hat sie Einfluss auf Ihr Schreiben? Oh ja, viel mehr Musik, als ich hier nennen könnte. Neben den Schubert-Liedern und seinen späten Klaviersonaten, gespielt von Swjatoslaw Richter! ist es vor allem Bach, ohne dessen Musik ich mir ein Leben eigentlich nicht vorstellen könnte. Wiederum Sjwatoslaw Richter sagte: »Es schadet nichts, ab und zu Bach zu hören, und sei es nur aus hygienischen Gründen.« Neben allen anderen Gründen für mich würde ich durchaus auch diesem zustimmen. Bach hat eine reinigende Wirkung auf mein Gemüt. Man kommt zu sich – und man sieht über seine eigene Begrenztheit hinaus. Und das hat sicherlich großen Einfluss auf mein Schreiben, weil es Einfluss auf mein Sein hat. Keineswegs zu verachten oder zu vernachlässigen ist aber auch die sogenannte U-Musik, Pop. Es gibt eine Art Soundtrack, eine innere Jukebox, die in allen möglichen Situationen anspringt, eben oft auch beim Schreiben. Das fließt dann nicht selten als direktes oder indirektes Zitat ein. Banal gesagt, hat Musik für mich einen enormen Einfluss auf meine Stimmungen, und die Stimmungen haben einen enormen Einfluss auf das Schreiben.
Können Sie sich Ihre Lyrik klingend vorstellen? Ist bei ihrer Entstehung ein Klang im Ohr? Keiner im Sinne von Musik, es ist, wie gesagt, die Sprache selbst, die klingen muss. Und anders klingend, also mit einer Melodie versehen, kann ich mir meine Gedichte eigentlich nicht vorstellen, aber das liegt vielleicht an meinem mangelnden Vorstellungsvermögen oder dass ich nicht wie eine Musikerin denke. Um ehrlich zu sein, gab es bereits eine Vertonung von Gedichten von mir, der ich zwar zugestimmt hatte, vor der ich mich dann aber fürchtete. Ich habe die CD bis heute nicht angehört.
Würde es Sie reizen, Songtexte zu schreiben? Ich glaube nicht. Ich schätze gute Songtexte sehr, aber sie setzen eine ganz andere Art des Arbeitens voraus, die mir, glaube ich, nicht gegeben ist. Man muss dabei etwas zu Papier bringen, was allein auf dem Papier womöglich noch nicht so überzeugend wirkt, man muss etwas Uneigenständiges schaffen und natürlich die Musik mitdenken können. Meine Gedichte sind auch meinem eigenen Empfinden nach relativ komplexe sprachliche Gebilde, die allerdings nicht aus einer Abneigung gegen Einfachheit so sind, sondern weil ich es schlichtweg nicht anders kann und weil der Reiz für mich eben auch darin liegt, etwas Mehrdeutiges, Mehrschichtiges zu schaffen, als kompaktes Gebilde. Das stünde einem guten Songtext mit Sicherheit im Wege.
Welche Nähe oder Distanz brauchen Sie zum Sujet, um in einen Arbeitsprozess zu kommen? Arbeit auf Bestellung versuche ich eher zu vermeiden, schon Themenvorgaben bei Literaturwettbewerben oder für Stipendien schrecken mich ab. Eine Ausnahme sind natürlich die seltenen Fälle, in denen eigenes Interesse und Auftrag zusammenfallen. In einem erweiterten Sinne sind ja z.B. auch Übersetzungsarbeiten Auftragsarbeiten, auch wenn ich nur Texte übersetze, die mir liegen oder dies zumindest vor Beginn der Arbeit glaube, d.h. es gibt zumindest eine Deadline und es ist sprachlich kein so freies Arbeiten wie an meinen eigenen Texten; man könnte sagen, der Auftrag geht in diesem Fall am stärksten vom Originaltext selbst aus. Letztlich aber »beauftrage« ich mich ja auch bei einem Roman oder Gedicht mit einer Arbeit, ich verlange mir einen Text ab, und zwar einen, der meinen Ansprüchen genügt, und der bereits geschriebene Text stellt wieder neue Aufträge und Ansprüche. Erst wenn ich mich in diese selbstgeschaffene Auftragssituation begebe, also begreife, dass sie mit Arbeit verbunden ist, kann ich auf die Inspiration, den Fluss, die Leichtigkeit hoffen, und das sind seltene Phänomene.
Das Gespräch führte Klaus-Martin Bresgott.
—
Judith Zander, geboren 1980 in Anklam Studium der Germanistik, Anglistik sowie Mittlere und Neuere Geschichte in Greifswald, anschließend bis 2006 am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, seither als freie Schriftstellerin in Berlin.
—
Werke, Preise – 2010 »Dinge, die wir heute sagten«, Debütroman, Uwe-Johnson-Förderpreis der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft – 2011 »oder tau«, Lyrikband dtv, Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis beim Leonce-und-Lena-Wett – 2014 »manual numerale«, Lyrikband dtv – 2010 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb – 2011 Writer-in-residence an der University of Western Sydney – 2015 Poesiepreis des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im BDI
—
8.
ausgewandert ist mein weg aus dem landschaftsgarten wo’s natürlich zugeht wie auf arkadiens karten wo seit jeher tümpel schon sich mit tempeln paarten wege schlängeln dürfen bis sie ans ziel geraten
(aus: manual numerale)
18.
als trostschluss nimmt sich das verdammt fidel aus dass tage die in nächten steckenbleiben grad bleiben weil sie, unsichtbarer kehllaut, die wirklichkeit anlauten und beleiben verkörpern wovon schamlos wir bloß schreiben in büchern tagebüchern testamenten ins mögliche unwirkliches zu treiben sags umgekehrt – es ist wie mit den enten die bleiben wer weiß wo schon wenns zufriert dort im central
park south und sonstigen verwandten orten verwendeten die sich im rucksack tragen wie umgepolte kompässe kohorten von mind games zu entfliehn gleichwohl zu zagen auf parties sich mit rucksäcken zu plagen unmöglich scheint als tatsache entbehrlich wie wilderei denn fraglich ist schon jagen wir bringen nichts nach haus dies aber herrlich verschreiben uns im dunkeln und sind bis morgen ehrlich
(aus: manual numerale)