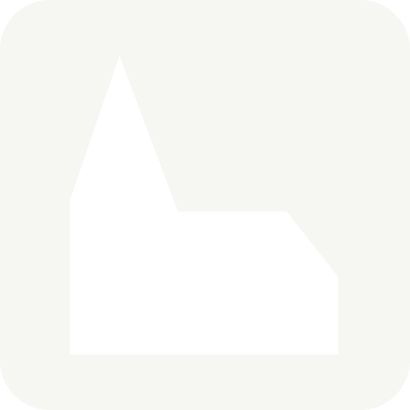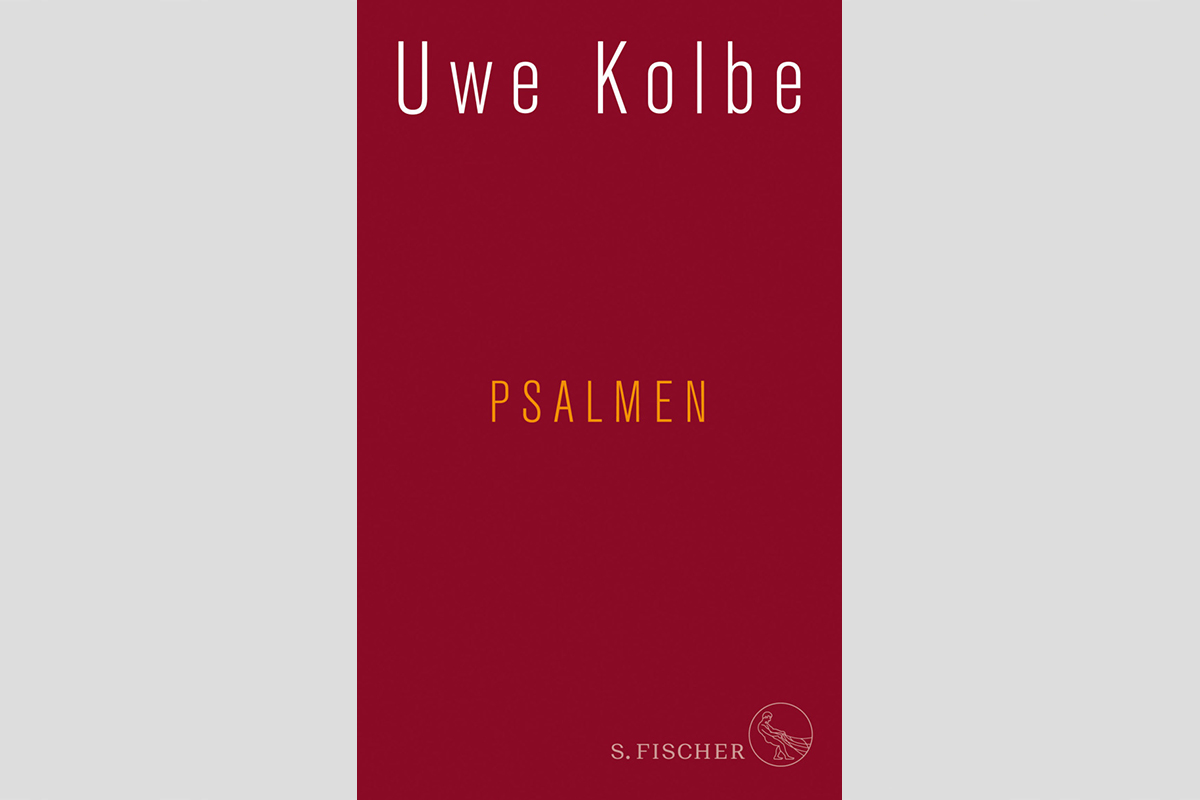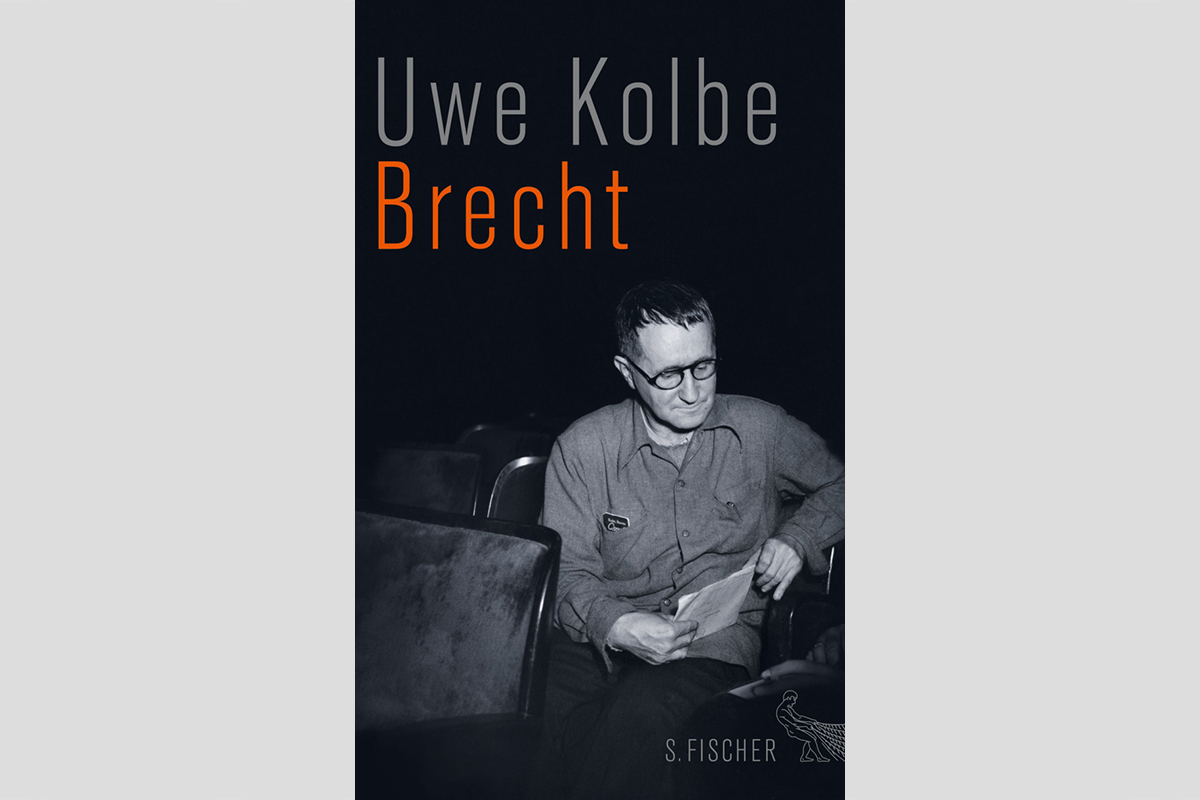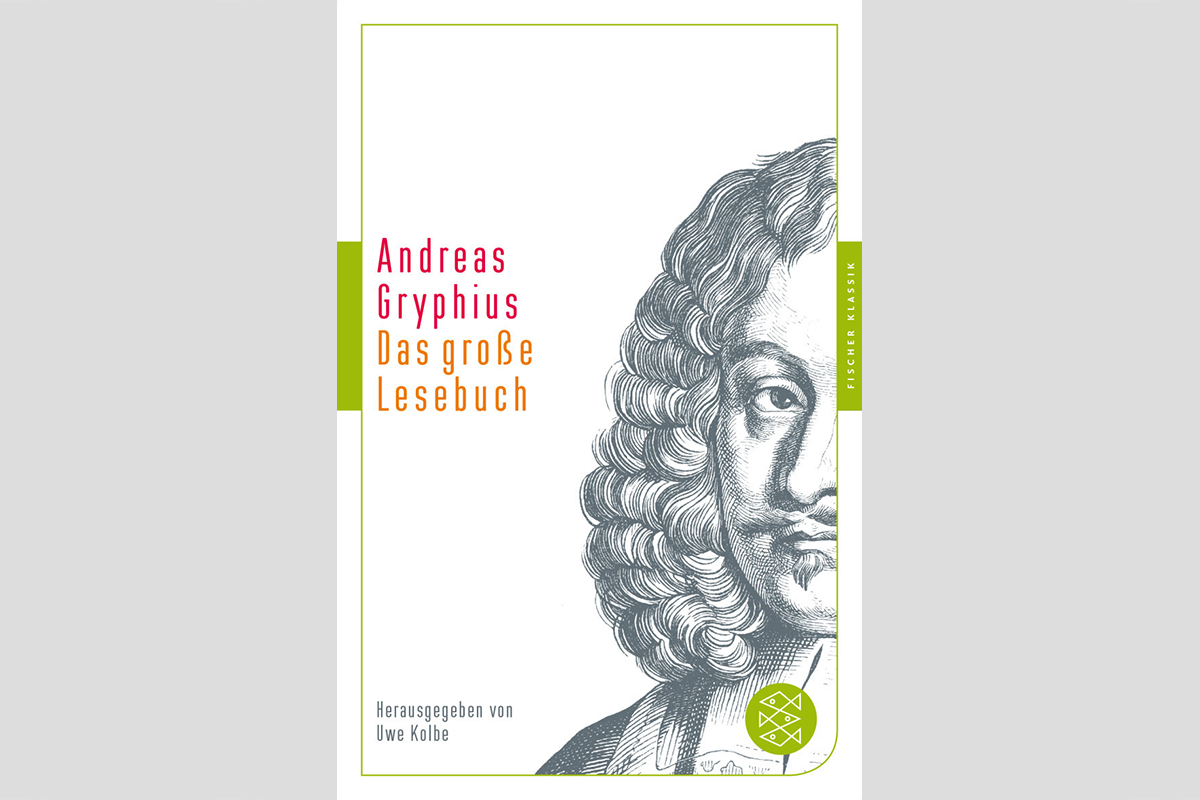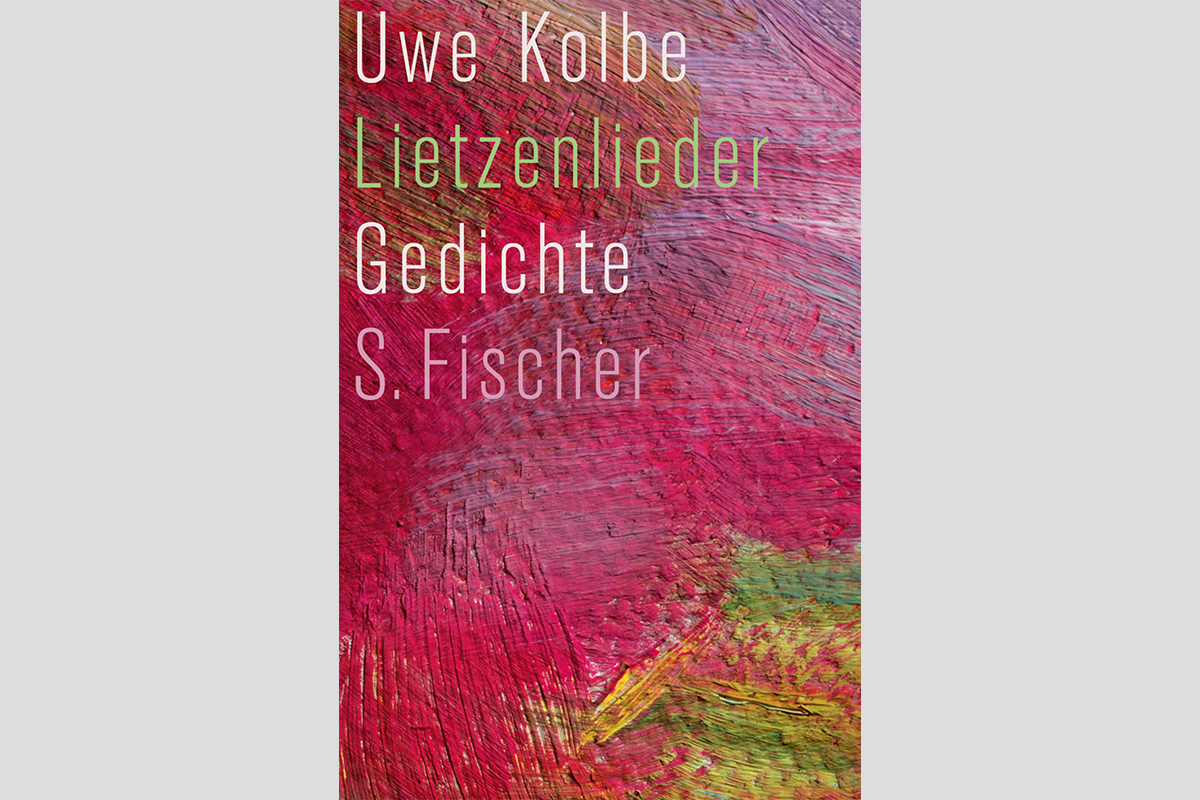Uwe Kolbe – Schriftsteller
Foto: Gaby Gerster
Uwe Kolbe – Schriftsteller
Meine erste Begegnung mit dem heute etablierten Schriftsteller und Dichter Uwe Kolbe war 1984 – »Male« und »Hymnen«, Gedichte, die ich mir abschrieb aus seinem Erstling »Hineingeboren«, der 1980 im Aufbau-Verlag erschienen war. Es waren Gedichte mit einem neuen Ton, der mich ebenso betroffen gemacht wie ermutigt hat. Ich war 17. Plötzlich stand für mich statt des in Reim und Versmaß gehüllten, sehnsuchtsverhafteten Gestern eines Rainer Maria Rilke und eines Stefan George eine brockenhafte Poesie des Daseins in der Tür, die sich nicht traumverloren wiederholen, sondern im Aufstoßen hautnah spüren ließ – Worte aus Wirklichkeit, Bilder aus Bleiben und Sein im Selbst. »Zwiefache Psychologie, zeitlich begrenzt« war für mich wie ein neuer Werther. Wirklich und wahr. Erschreckend und tröstlich gleichermaßen.
Was mir seinerzeit als unerhörter Neuanfang erschien und eine mutvoll sprachliche Dringlichkeit aufzeigte, steht mit der Zeit doch in einer sich fortschreibenden lyrischen Tradition. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Zugehörigkeit dazu? Wo wurzelt Ihre Sprache? Auf den ersten Blick könnte Ihre Einstiegsfrage mich in Verlegenheit bringen. Sie wäre zu verstehen als Nachfrage, wo Mut, Dringlichkeit, Aufbegehren gegen Sprachkonvention abgeblieben sind. Sie konfrontieren den reifen Autor mit seinen Anfängen vor vierzig Jahren. »Hineingeboren« erschien 1980 in Ostberlin, der Untertitel verweist stolz auf die Entstehungszeit: »Gedichte 1975–1979«. Schon damals wäre die Behauptung unhaltbar gewesen, diese Gedichte seien sprachlich unmittelbarer Ausdruck der Existenz unter bestimmten und bestimmenden Umständen. Der in dieselben hineingeboren war, wurde früh genug ein Leser. Er hatte sich von seinem siebten Lebensjahr an durch die nächstgelegene öffentliche Bibliothek gefressen, war den Brüdern Grimm und Musäus, Hauff und Andersen, Welskopf-Henrich und Stanisław Lem begegnet, zuletzt sogar Miguel Angel Asturias und William Faulkner. Gedichte waren neben den schulisch obligaten nicht darunter. Vielleicht mal ein kurzer Blick zu Pablo Neruda in der Fassung von Erich Arendt, aber das drang noch nicht durch. Nach sieben Jahren Lesen, im vierzehnten Lebensjahr geschah etwas anderes. Der Pubertierende schlug die »Menschheitsdämmerung« auf (Reclams Universalbibiothek, Leipzig 1972). Das war Sprache, Gedicht, das war seine Sache. Sicher hatte das fast ungläubige Staunen, wie sehr das alles zutraf und ihn deshalb traf, auch mit Urbanität, mit dem historisch passgenauen Fall, mit der Stadt Berlin und dem Nachkriegszustand der eigenen Erfahrung, des eigenen Augenscheins zu tun. In dieser Sprache, in ihrer sofort angeeigneten Form konnte nun er sagen, was er sah und was er schon zu denken im Stande war. Will sagen: Lyrische Tradition von Anfang an. Klassische Moderne. Hinter antipodischen Expressionisten wie Benn und Trakl schienen Nietzsche und Hölderlin einerseits wie die französische Moderne andererseits auf. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud folgten auf dem Fuße. Brecht, früher Enzensberger, die Spanier der Gruppe 27 auch gleich dabei. Ich war, nebenbei bemerkt, Rilke nicht abgeneigt, schon damals nicht. Und die andere Linie, die von den mittelalterlichen Versepen zu Heine führte, in der leichtesten Version zu Biermann, sie zwinkerte herein und schrieb sofort mit. Ich las den »Atta Troll« und das Heinesche »Wintermärchen« und kopierte halbe Jahre lang deren schnittige Versform, ohne dass es viel taugte. Aber es übte. Und nun die große Frage, wo meine Sprache wurzelt … in der Mutterzunge mit Dialekt, verballhornter Grammatik, drolligen Fehlern im Wortschwall einerseits und andererseits bei einer Internationale von Ägyptern, Griechen, Lateinern, Renaissance-Italienern und Angelsachsen, den Dichtern der französischen und mittelhochdeutschen Versepen, Bibelübersetzern und all denen, die ihnen bis heute nachfolgen. Apropos Übersetzerinnen und Übersetzer – ohne die unermüdliche Begleitung dieser Zeitgenossen gäbe es mich überhaupt nicht. Und auch die folgende Wiederholung noch: Wer mit 25 Jahren nicht die Tradition kennt, in der seine eigene Arbeit steht, wird kein Dichter bleiben. Als ich das bei T.S. Eliot las, war ich 25 Jahre alt. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Das Gedicht »Schnitte « aus Ihrem 2012 veröffentlichten Band »Gegenreden« eröffnet mit dem Vers »Sie wissen schon, die Ausschnitte sind es, / Dünnschnitte aus Leben und Tod«. Auch wenn das Gedicht einen anderen Weg nimmt – markiert diese Beschreibung für Sie jenen Moment, aus dem ein Gedicht wird? Ihre Vermutung trifft ins Schwarze, wenn auch nicht in der Verabsolutierung, dass es »jener Moment« sei. Jedes meiner Gedichte bringt wahrscheinlich diesen eigenen Moment mit und verweist auch irgendwie, irgendwo darauf oder trägt eine geheime Spur davon in sich (die nicht ganz aufzuklärende Fügung, das eine Wort oder Komma). Gelegenheitsgedichte tun das gern, es gehört zu ihnen. Sie führen mit sich »das Akzidentielle«, gegen das Hölderlin sich aussprach, es jedoch selbst immer wieder stehen ließ, als Ort und Landschaft oder persönlichen Zusammenhang. Wir lassen den Grund des Gedichts beiseite, der liegt immer woanders, eventuell tiefer oder abseits. Anlass aber, Auslöser des Gedichts mag im konkreten Fall ein Schock sein – den Hinweis auf die tödliche Krankheit im Dünnschnitt zu erkennen –, und unvermittelt vor Leben und Tod zu stehen. Der von Ihnen zitierte Anfang verweist ja mit dem Wort »Dünnschnitte« auf die Präparationstechnik. Es geht um etwas wie mikroskopische Einsicht in das, was da ist. Das weitere Gedicht bleibt dann bei der Draufsicht, bei einer sichtbaren, äußerlichen Situation.
Ist Schreiben für Sie eine Herausforderung oder eine Erleichterung? Verknüpft sich mit dem öffentlich gemachten Vers ein Wunsch? Oder eine Erwartung? Wie viel Resonanz braucht der Dichter? Gedichte zu schreiben wäre Herausforderung für diejenigen, die es nicht aushalten, jedes Mal bei Null anzufangen: Du hast kein rohes Holz, keinen Mörtel, keinen Stein. Und obendrein existiert das Handwerkszeug nur in deinem Kopf. Wenn eine Form erarbeitet, ein poetisch Funktionierendes hergestellt ist, kann sich durchaus Erleichterung einstellen, sogar Freude. Im nächsten Schritt setzt du es oder kippst es – je nach Temperament – auf den riesigen Haufen, Berg und Scherbenberg der deutschsprachigen Dichtung! Resonanz braucht jeder, der etwas auf diese Art in die Welt gibt. Ein Schelm, wer anderes behauptet. Wenn es keine spürbare Rezeption, keine Resonanz gibt, wenn sie sogar verweigert wird, wenn du an den Katzentisch gesetzt wirst, kommt es auf die Wenigen an. Deren Wort, sagen wir in einem Brief, auf einer Postkarte, in einer E-Mail oder über einem Glas Wein, davon lebst du dann. Damit kannst du lange durchhalten. Als Gegenüber hat mein Gedicht ja immer wieder auch Gott, aktuell ausdrücklich in den »Psalmen«. Nur ist dessen Resonanz so langwellig, man müsste ein Ozean oder ein Planet sein, um sie zu fühlen.
Sind Veröffentlichungen für Sie eine Entledigung notwendig ausgesprochener Verse? Sind sie ein Ruf in die Welt? Oder werden ihre Verse in die Welt »hineingeboren« – in Anlehnung an Ihren ersten Gedichtband? Gedichtbände machen meine Arbeit sichtbar, sind Produkte, im besten Fall ansehnliche und genießbare, notwendiger Teil der Berufsausübung. Aber ich scheue mich nicht, wie zu Zeiten größter Naivität darauf zu beharren, dass jedes echte, also dringliche und gelungene Gedicht das Gespräch sucht und der Antworten würdig ist. Zum Beispiel so, wie Gedichte der Tradition, gleich aus welcher Sprache, von jeweils Heutigen beantwortet werden, gelesen, zitiert, rezitiert, gesungen, weitergegeben, sodass sie nicht aufhören, im Chor der Sprachen der Welt mitzuklingen.
Ihr aktueller Gedichtband heißt »Psalmen« – was singen Sie? Und wem? Was meine Psalmen singen, kann ich nicht in anderen Worten sagen und bitte um Lektüre. Ansonsten belegen sie unmissverständlich Zwiesprache mit Gott. Ich werde diesem Gott nur nicht die Maske einer bestimmten Konfession vor das Gesicht hängen.
Wie nah ist Ihren Worten die Musik? Verbinden Sie Ihre Rhythmik innerlich mit Klang? Musik und lyrisches Sprechen stehen im elementaren Zusammenhang. Sie entstammen derselben Quelle. Darauf verweist der Mythos von Orpheus. Neben dieser Grundlage ist lyrisches Sprechen für mich nur gebunden vorstellbar und sinnvoll. Gedicht und Musik treffen sich im Umgang mit Maßen und im Begriff von Maß und Form. Es sind verschiedene Systeme von Maßen, Maß anlegen, Maß finden. Die Kategorien und äußeren Formen sind überwiegend andere, die Notierung bis auf Übergangsformen wie Schwitters Ursonate und ähnliches sowieso. Der Umgang mit Zeit, Rhythmus, Melodie, Klang ist ganz anders, aber schon die Begriffe belegen die Parallele. Komponisten und Dichter wissen das voneinander. Es ist im bösen Fall die Wissenschaft und in ihrem Gefolge die Kritik, die davon aus fadenscheinigen Gründen nichts wissen wollen. Eine andere Sache ist die Vertonung von Gedichten, das sogenannte Kunstlied. Es hat im Laufe der letzten einhundert Jahre an Bedeutung verloren. Aber es haben sich zu allen Zeiten auf allen Gebieten der Kunst Genres, Formen, Stilistiken und handwerkliche Spezialisierungen voneinander emanzipiert, um irgendwann auch wieder zu kollaborieren. Auf den Bühnen der Populärkultur, im Theater und im Film tun sie es ja sowieso.
Haben Sie manchmal das Gefühl, alles gesagt zu haben? Oder gehen Ihnen – wie im Alltag – die »Handarbeiten« – wie Ihr zehnteiliger Zyklus in den »Gegenreden« lapidar überschrieben ist – nie aus? Der Begriff Handarbeiten in dem Band »Gegenreden« von 2015 ist ein leicht ironischer Hinweis auf den Ort, an dem der Zyklus entstanden ist. Es handelt sich um ein Häuschen am Rande von Otterndorf, das einmal für Damen der Gesellschaft gebaut worden war. Sie trafen sich dort zu Tee und Handarbeiten. Ich residierte da einmal als Stadtschreiber. Es passte mir ganz gut, weil ich meine Ehre wie gesagt durchaus im Handwerk des Gedichteschreibens sehe. Von einem Moment auf den anderen ausgeschrieben zu sein, alles gesagt zu haben, damit lebt jede und jeder, die oder der Gedichte schreibt. Es soll auch welche geben, die jenseits des Punkts weiter schreiben. Aber das erkennen die Leser ja, nicht wahr?
Das Gespräch führte Klaus-Martin Bresgott.
—
Uwe Kolbe, geboren 1957 in Ostberlin 1976 Abitur in Berlin-Pankow; anderthalb Jahre Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee der DDR; 1983–1987 Mitherausgeber der Samisdat-Zeitschrift »Mikado«; 1986 und in späteren Jahren mehrmals Stipendiat der Stiftung Kulturaustausch in Amsterdam; 1987 Stipendium Stiftung Künstlerhaus Worpswede; 1988–1993 ansässig in Hamburg-Altona; im Herbst 1989 Poet in Residence an der University of Texas at Austin; 1992 Villa Massimo, Rom; 1993–1997 ansässig in Berlin-Prenzlauer Berg; 1997–2002 in Baden-Württemberg; 1997–2004 Leiter des Studios Literatur und Theater der Eberhard-Karls-Universität Tübingen; 2002–2013 ansässig in Berlin-Charlottenburg; 2007 und 2013 Max Kade Writer in Residence am Oberlin College, Oberlin, Ohio; 2010 Max Kade Writer in Residence am Allegheny College, Meadville, Pennsylvania; Stipendien als Stadtschreiber in Stade (2004), Rheinsberg (2005), Calw (2011), Otterndorf (2014), Dresden (2017); seit 2013 in Hamburg-Rahlstedt.
—
Werke, Preise – 1980 »Hineingeboren«, Gedichte – 1988 Nicolas-Born-Preis für Lyrik – 1992 Stipendium der Villa Massimo, Berliner Literaturpreis – 1993 Friedrich-Hölderlin-Preis der Universität und der Universitätsstadt Tübingen – 2006 Preis der Literaturhäuser – 2012 »Lietzenlieder«, Gedichte; Heinrich-Mann-Preis – 2012 Lyrikpreis Meran – 2014 »Die Lüge«, Roman; Menantes-Preis für erotische Literatur – 2015 »Gegenreden«, Gedichte; Reiner-Kunze-Preis – 2016 »Brecht. Rollenmodell eines Dichters«, Essay; Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung – 2017 »Psalmen«, Gedichte
—
Zwiefache Psychologie, zeitlich begrenzt
Ich verschließe mich still vor allen Freunden und gebe mich laut vor allen Fremden.
Mein Gesicht liegt leuchtend in einem dunklen Raum, hinter unscheinbarer, offner Tür.
Ich tue so kompliziert, so, dabei genügte ein klarer Schnitt, mit scharfem Messer durch meines Leibs und Kopfes schwache Mitte.
(flüsternd: seid meiner gewiß)
Ich senke die Lider, beschleunige unruhig den Schritt.
(aus: »Hineingeboren«, 1980)